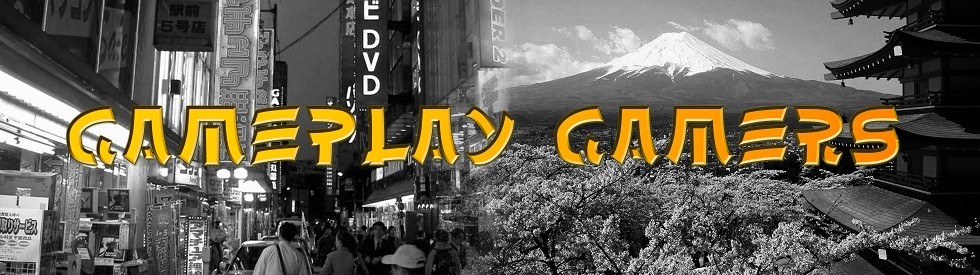Häufig gibt es Anime, die mit experimentellen Gestaltungsweisen auf sich aufmerksam machen wollen. Selten handelt es sich dabei jedoch um eine Serie mit mehr als zwanzig Episoden, wie es bei Texhnolyze von Animationsstudio Madhouse aus dem Jahre 2003 der Fall ist.
Häufig gibt es Anime, die mit experimentellen Gestaltungsweisen auf sich aufmerksam machen wollen. Selten handelt es sich dabei jedoch um eine Serie mit mehr als zwanzig Episoden, wie es bei Texhnolyze von Animationsstudio Madhouse aus dem Jahre 2003 der Fall ist.
 Texhnolyze macht von der ersten Minute an keinen Hehl daraus, den Zuschauer eine heile Welt vorzuspielen. In dieser Anime-Serie handelt es sich um das genaue Gegenteil, denn die Gesellschaft hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt und das wird auch genauso unkaschiert dargestellt. Das Erscheinungsbild des Universums kann von Beginn als ein sehr dystopisches Abbild der Realität eingestuft werden und reiht sich damit zugleich in die Riege von diversen Cyberpunk-Filmen und -Serien ein. In der Welt von Texhnolyze dreht alles um die titelgebende Texhnolyze-Technologie. Diese ist deshalb so bedeutend, weil es für die Menschen – zumindest in der Theorie – möglich ist, ihre Körperteile gegen künstliche auszuwechseln. Dies hat den netten Nebeneffekt, dass das eigene Leben verlängert werden kann. Es ist daher wohl auch kaum verwunderlich, dass Texhnolyze die Gesellschaft spaltet: Aufgrund dessen, dass die Technologie teuer ist, profitieren nur die Privilegierten davon. Ihre neuen Körperteile sind deshalb sowohl Luxus als auch Statussymbol. Allgemein herrscht jedoch Armut in der Welt von Texhnolyze, die auf die technische Errungenschaft zurückzuführen ist. Durch den häufigen Einsatz von diversen Elementen des Cyberpunk-Genres bleibt die Welt bis zum sehr philosophisch hinterfragten Ende der Serie düster und regelrecht hoffnungslos.
Texhnolyze macht von der ersten Minute an keinen Hehl daraus, den Zuschauer eine heile Welt vorzuspielen. In dieser Anime-Serie handelt es sich um das genaue Gegenteil, denn die Gesellschaft hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt und das wird auch genauso unkaschiert dargestellt. Das Erscheinungsbild des Universums kann von Beginn als ein sehr dystopisches Abbild der Realität eingestuft werden und reiht sich damit zugleich in die Riege von diversen Cyberpunk-Filmen und -Serien ein. In der Welt von Texhnolyze dreht alles um die titelgebende Texhnolyze-Technologie. Diese ist deshalb so bedeutend, weil es für die Menschen – zumindest in der Theorie – möglich ist, ihre Körperteile gegen künstliche auszuwechseln. Dies hat den netten Nebeneffekt, dass das eigene Leben verlängert werden kann. Es ist daher wohl auch kaum verwunderlich, dass Texhnolyze die Gesellschaft spaltet: Aufgrund dessen, dass die Technologie teuer ist, profitieren nur die Privilegierten davon. Ihre neuen Körperteile sind deshalb sowohl Luxus als auch Statussymbol. Allgemein herrscht jedoch Armut in der Welt von Texhnolyze, die auf die technische Errungenschaft zurückzuführen ist. Durch den häufigen Einsatz von diversen Elementen des Cyberpunk-Genres bleibt die Welt bis zum sehr philosophisch hinterfragten Ende der Serie düster und regelrecht hoffnungslos.
Umherirrende Seelen in einer hoffnungslosen Welt
 Handlungsort von Texhnolyze ist die fiktive Untergrundstadt Lukuss, in der die ausweglose Lage noch dazu mit reichlich Gewalt, ausgelöst von verschiedenen dominierenden Banden und Organisation, unterlegt wird. Die meiste Zeit über wird die Geschichte von Texhnolyze sehr ruhig erzählt. Beispielsweise kommt die erste Hälfte der ersten Episode ohne Dialoge aus – selbst in späteren Folgen sind längere Phasen ohne gesprochenen Text absolut keine Seltenheit. Erzählt wird die Geschichte aus mehreren Perspektiven von diversen Figuren, die sich im Verlauf der Story mehrfach begegnen oder gar Teile ihres Wegs miteinander teilen. Unter anderem wird der Leidensweg von Ichise gezeigt, der zu Beginn der Handlung seinen Arm und sein Bein verliert. Von der Wissenschaftlerin Kamata Eriko wird er kurz darauf mit der nötigen Technologie ausgestattet, was zu einem inneren Konflikt führt. Hier prallen sein Überlebenswillen und seine Ablehnung Texhnolyze gegenüber aufeinander. Interessant ist auch der Charakter Yoshii Kazuho, der unterwegs auf das kleine Blumenmädchen Ran trifft, die in die Zukunft blicken kann. Über seine Absichten wird der Zuschauer anfangs arg im Dunkeln gelassen, er selbst will auch nicht, dass Ran ihn über seine Zukunft belehrt. Story und Charaktere ergänzen sich auf dieser Ebene, ohne viele Worte zu verlieren, hervorragend.
Handlungsort von Texhnolyze ist die fiktive Untergrundstadt Lukuss, in der die ausweglose Lage noch dazu mit reichlich Gewalt, ausgelöst von verschiedenen dominierenden Banden und Organisation, unterlegt wird. Die meiste Zeit über wird die Geschichte von Texhnolyze sehr ruhig erzählt. Beispielsweise kommt die erste Hälfte der ersten Episode ohne Dialoge aus – selbst in späteren Folgen sind längere Phasen ohne gesprochenen Text absolut keine Seltenheit. Erzählt wird die Geschichte aus mehreren Perspektiven von diversen Figuren, die sich im Verlauf der Story mehrfach begegnen oder gar Teile ihres Wegs miteinander teilen. Unter anderem wird der Leidensweg von Ichise gezeigt, der zu Beginn der Handlung seinen Arm und sein Bein verliert. Von der Wissenschaftlerin Kamata Eriko wird er kurz darauf mit der nötigen Technologie ausgestattet, was zu einem inneren Konflikt führt. Hier prallen sein Überlebenswillen und seine Ablehnung Texhnolyze gegenüber aufeinander. Interessant ist auch der Charakter Yoshii Kazuho, der unterwegs auf das kleine Blumenmädchen Ran trifft, die in die Zukunft blicken kann. Über seine Absichten wird der Zuschauer anfangs arg im Dunkeln gelassen, er selbst will auch nicht, dass Ran ihn über seine Zukunft belehrt. Story und Charaktere ergänzen sich auf dieser Ebene, ohne viele Worte zu verlieren, hervorragend.
Experimentelle Gestaltungsweisen
 Eines der wichtigsten optischen Kriterien ist die Gewalt, die sehr stark übertrieben und häufig sogar stilisiert dargestellt wird. Dazu gesellen sich dunkle beziehungsweise triste Farben, die höchstens von elektrischem Licht durchdrungen werden. Wenn die Farbe Rot eingesetzt wird, ist meistens das ganze Bild davon betroffen. Helle Farben sind aber stets in der Unterzahl, im großen Finale wird aus erzähltechnischen Gründen aber steter Gebrauch davon gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die meist sehr ruhigen Kamerafahrten und meist sehr starren Kameraeinstellungen. Die verschiedenen Darstellungsmethoden sind wie schon bei Serial Experiments Lain als sehr experimentell einzustufen, was so auch auf den Rest der Serie übertragbar ist. Somit verkommt auch die Musik zur Nebensache, denn meist sind es nur die Soundeffekte wie Schüsse einer Maschinenpistole, der Schrei eines Sterbenden oder auch nur die industriellen Fabrikgeräusche, die überaus häufig im Vordergrund stehen. Auch wenn der japanische Originalton alleine aufgrund der Klangqualität zu bevorzugen ist, kann die deutsche Synchronisation mit talentierten Sprechern wie Erich Räuker oder Stefan Gossler, die in Anime-Produktionen nur selten zu hören sind, überzeugen. Bonusmaterial liegt, wie für Nipponart typisch, nur in Form eines kleinen Posters und einer Stickers bei. Das ist schade, experimentierfreudige Anime-Fans werden sich davon aber kaum vom Kauf abhalten lassen.
Eines der wichtigsten optischen Kriterien ist die Gewalt, die sehr stark übertrieben und häufig sogar stilisiert dargestellt wird. Dazu gesellen sich dunkle beziehungsweise triste Farben, die höchstens von elektrischem Licht durchdrungen werden. Wenn die Farbe Rot eingesetzt wird, ist meistens das ganze Bild davon betroffen. Helle Farben sind aber stets in der Unterzahl, im großen Finale wird aus erzähltechnischen Gründen aber steter Gebrauch davon gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die meist sehr ruhigen Kamerafahrten und meist sehr starren Kameraeinstellungen. Die verschiedenen Darstellungsmethoden sind wie schon bei Serial Experiments Lain als sehr experimentell einzustufen, was so auch auf den Rest der Serie übertragbar ist. Somit verkommt auch die Musik zur Nebensache, denn meist sind es nur die Soundeffekte wie Schüsse einer Maschinenpistole, der Schrei eines Sterbenden oder auch nur die industriellen Fabrikgeräusche, die überaus häufig im Vordergrund stehen. Auch wenn der japanische Originalton alleine aufgrund der Klangqualität zu bevorzugen ist, kann die deutsche Synchronisation mit talentierten Sprechern wie Erich Räuker oder Stefan Gossler, die in Anime-Produktionen nur selten zu hören sind, überzeugen. Bonusmaterial liegt, wie für Nipponart typisch, nur in Form eines kleinen Posters und einer Stickers bei. Das ist schade, experimentierfreudige Anime-Fans werden sich davon aber kaum vom Kauf abhalten lassen.
Geschrieben von Eric Ebelt
Erics Fazit (basierend auf der Blu-ray-Fassung): Texhnolyze erzählt zwar keine durch und durch stringente Handlung eines bestimmten Helden, doch das muss die Anime-Serie auch gar nicht schaffen. Sie ist in allen Belangen als sehr experimentell einzustufen, sodass eher das Universum als die Akteure in diesem im Mittelpunkt steht. Von der ersten Minute an zeichnet Texhnolyze auf diesem Weg ein düsteres, gar hoffnungsloses Szenario, aus dem es kein Entkommen gibt. Die düstere Atmosphäre der Cyberpunk-Anime-Serie paralysiert vom ersten Augenblick an und lässt einen bis zum Ende nicht mehr los. Zunehmend hinterfragen die Figuren ihre Welt mit philosophischen Gedanken oder werden mit diesen konfrontiert. Hinzu kommt der aufs Nötigste reduzierte Einsatz von Musik, die eher Soundeffekte für sich sprechen lässt. Ebenso ist es den ruhigen Kamerafahrten und starren Kameraperspektiven geschuldet, die Texhnolyze zu einem sehr einzigartigen Genuss für experimentierfreudige Anime-Zuschauer macht, der garantiert nicht so schnell von diesen vergessen werden kann.
Vielen Dank an Nipponart für die freundliche Bereitstellung eines Rezensionsexemplars von Texhnolyze (Collector’s Edition)!
© RONDO ROBE TEXHNOLYZE COMMITTEE. All rights reserved. (Bildmaterial)