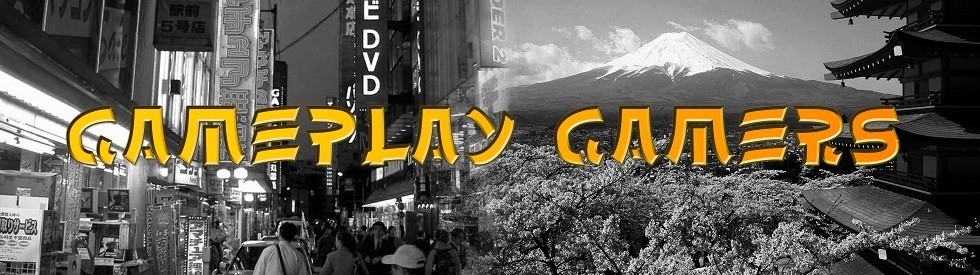Anime haben sich heutzutage einen festen Platz in der Welt der Unterhaltungskultur gesichert. Mit unserem Special wollen wir euch an dieser Stelle die geschichtliche Entwicklung des Anime in Japan vorstellen und euch so ein klein wenig bekannter mit diesem faszinierenden Medium machen.
Anime haben sich heutzutage einen festen Platz in der Welt der Unterhaltungskultur gesichert. Mit unserem Special wollen wir euch an dieser Stelle die geschichtliche Entwicklung des Anime in Japan vorstellen und euch so ein klein wenig bekannter mit diesem faszinierenden Medium machen.
 Lässt man die USA und den Disney-Konzern einmal außen vor, so findet sich heute wohl kaum ein Land, dessen Animationswerke sich im Ausland so großer Beliebtheit erfreuen, wie dies für Japan der Fall ist. Anime gelten als Inbegriff japanischer Kultur und haben in vielen Ländern eine große Fangemeinde um sich versammelt, die die neuesten Veröffentlichungen kaum abwarten kann und rund um ihr Hobby eine Vielzahl von Aktivitäten veranstaltet. Dies war aber längst nicht immer der Fall. Der Begriff „Anime“ selbst, der sich von dem englischen Wort „animation“ ableitet, ist in Japan erst seit den 1960er Jahren gebräuchlich. Während man das Wort hierzulande aber ausschließlich für japanische Produkte verwendet, wird er in Japan benutzt, um alle Arten von Zeichentrickfilmen und –serien zu bezeichnen. Davor sprach man lange Zeit von „dōga“ (bewegte Bilder) oder „manga eiga“ (Manga-Filme), wenn man Zeichentrickfilme meinte. Die Anfänge des japanischen Animationsfilms reichen dabei bis in die Zeit der 1910er und 1920er Jahre zurück, als die ersten Werke aus den USA und Europa dem japanischen Publikum zugänglich gemacht wurden und im Anschluss japanische Künstler wie Shimokawa Ōten (1892-1973) den westlichen Vorbildern nacheiferten. Leider sind von den Anfängen nicht mehr allzu viele Werke erhalten geblieben. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Zeichentrickfilme dann sowohl in Amerika als auch in Japan für Propagandazwecke missbraucht, wie etwa im Falle des 1943 erschienenen Momotarō no Umiwashi (Momotarōs Seeadler) geschehen.
Lässt man die USA und den Disney-Konzern einmal außen vor, so findet sich heute wohl kaum ein Land, dessen Animationswerke sich im Ausland so großer Beliebtheit erfreuen, wie dies für Japan der Fall ist. Anime gelten als Inbegriff japanischer Kultur und haben in vielen Ländern eine große Fangemeinde um sich versammelt, die die neuesten Veröffentlichungen kaum abwarten kann und rund um ihr Hobby eine Vielzahl von Aktivitäten veranstaltet. Dies war aber längst nicht immer der Fall. Der Begriff „Anime“ selbst, der sich von dem englischen Wort „animation“ ableitet, ist in Japan erst seit den 1960er Jahren gebräuchlich. Während man das Wort hierzulande aber ausschließlich für japanische Produkte verwendet, wird er in Japan benutzt, um alle Arten von Zeichentrickfilmen und –serien zu bezeichnen. Davor sprach man lange Zeit von „dōga“ (bewegte Bilder) oder „manga eiga“ (Manga-Filme), wenn man Zeichentrickfilme meinte. Die Anfänge des japanischen Animationsfilms reichen dabei bis in die Zeit der 1910er und 1920er Jahre zurück, als die ersten Werke aus den USA und Europa dem japanischen Publikum zugänglich gemacht wurden und im Anschluss japanische Künstler wie Shimokawa Ōten (1892-1973) den westlichen Vorbildern nacheiferten. Leider sind von den Anfängen nicht mehr allzu viele Werke erhalten geblieben. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Zeichentrickfilme dann sowohl in Amerika als auch in Japan für Propagandazwecke missbraucht, wie etwa im Falle des 1943 erschienenen Momotarō no Umiwashi (Momotarōs Seeadler) geschehen.
Unterhaltung in der Nachkriegszeit
 Die Geschichte des modernen Anime beginnt im Japan der Nachkriegszeit. Im Zuge des Wiederaufbaus gründeten sich auch mehrere Filmstudios, die die Bevölkerung mit Unterhaltung versorgen sollten. Zu den ersten und erfolgreichsten gehörte das Studio Tōei, das auch heute noch existiert und mit Dragonball oder One Piece den einen oder anderen Hochkaräter im Portfolio aufzuweisen hat. Zu einer der prägendsten Figuren der Nachkriegszeit avancierte der auch wegen seiner Innovationskraft heutzutage als „Gott des Manga“ verehrte Tezuka Osamu (1928-1989). Tezuka, der ein Fan von Walt Disney war, suchte sich Zeit seines Lebens immer neue Herausforderungen und wagte sich dabei auch an ernste und an Erwachsene gerichtete Themen. 1963 brachte sein Studio Mushi Production mit Astro Boy eine der ersten Anime-Serien auf den Markt, die aufgrund der geringen Produktionskosten und des begleitenden Merchandising ein finanzieller Erfolg und Vorreiter für andere Serien wurde. Manche bezeichnen die hier verwendete limited animation, die aufgrund besonderer Techniken – etwa der wiederholten Verwendung einzelner Bildelemente – mit verhältnismäßig wenigen Zeichnungen pro Sekunde auskommt, als etwas für Anime Typisches, tatsächlich aber arbeiteten amerikanische Serien wie The Flintstones (1959-1966) nach ähnlichem Muster. Es ist vermutlich als Ironie der Geschichte zu bezeichnen, dass sich ausgerechnet Disney nach der Veröffentlichung von Der König der Löwen (1994) von vielen Seiten den Vorwurf gefallen lassen musste, bei Tezukas Kimba, der weiße Löwe (1965-1966) abgekupfert zu haben.
Die Geschichte des modernen Anime beginnt im Japan der Nachkriegszeit. Im Zuge des Wiederaufbaus gründeten sich auch mehrere Filmstudios, die die Bevölkerung mit Unterhaltung versorgen sollten. Zu den ersten und erfolgreichsten gehörte das Studio Tōei, das auch heute noch existiert und mit Dragonball oder One Piece den einen oder anderen Hochkaräter im Portfolio aufzuweisen hat. Zu einer der prägendsten Figuren der Nachkriegszeit avancierte der auch wegen seiner Innovationskraft heutzutage als „Gott des Manga“ verehrte Tezuka Osamu (1928-1989). Tezuka, der ein Fan von Walt Disney war, suchte sich Zeit seines Lebens immer neue Herausforderungen und wagte sich dabei auch an ernste und an Erwachsene gerichtete Themen. 1963 brachte sein Studio Mushi Production mit Astro Boy eine der ersten Anime-Serien auf den Markt, die aufgrund der geringen Produktionskosten und des begleitenden Merchandising ein finanzieller Erfolg und Vorreiter für andere Serien wurde. Manche bezeichnen die hier verwendete limited animation, die aufgrund besonderer Techniken – etwa der wiederholten Verwendung einzelner Bildelemente – mit verhältnismäßig wenigen Zeichnungen pro Sekunde auskommt, als etwas für Anime Typisches, tatsächlich aber arbeiteten amerikanische Serien wie The Flintstones (1959-1966) nach ähnlichem Muster. Es ist vermutlich als Ironie der Geschichte zu bezeichnen, dass sich ausgerechnet Disney nach der Veröffentlichung von Der König der Löwen (1994) von vielen Seiten den Vorwurf gefallen lassen musste, bei Tezukas Kimba, der weiße Löwe (1965-1966) abgekupfert zu haben.
Ein frischer Wind für die Anime-Industrie
 Einen weiteren wichtigen Entwicklungsschub erlebte das Medium in den 1970ern mit Serien wie Space Battleship Yamato und Mobile Suit Gundam. Zu dieser Zeit entwickelten die Genres eine größere Bandbreite, die in Tōkyō stattfindende Manga-Messe Comiket wurde ins Leben gerufen und es traten auch die ersten Cosplayer in Erscheinung. Viele Studios verzichteten darauf, abendfüllende Trickfilme zu produzieren, da sich die Serien als das lukrativere Geschäft erwiesen. Diese Erfahrung mussten auch Takahata Isao und Miyazaki Hayao machen, die sich zunächst bei Tōei kennenlernten und 1968 mit dem Film Taiyō no Ōji: Horusu no Daibōken (Der Prinz der Sonne: Das große Abenteuer des Horus) grandios an den Kinokassen floppten. Es ist ein großes Glück, dass die beiden sich davon nicht aus der Bahn werfen ließen. Nachdem sie unter anderem an Heidi (1974) mitgearbeitet hatten, das damals ein Teil des World Masterpiece Theater war – ein Projekt, für welches bekannte Geschichten aus aller Welt als Anime-Versionen umgesetzt wurden – gründeten sie 1985, nach dem Erfolg von Nausicaä aus dem Tal der Winde (1984), das Studio Ghibli. Ghibli ist heute eines der erfolgreichsten und beliebtesten Studios und besitzt in Mitaka, einer Stadt westlich von Tōkyō, sogar sein eigenes kleines und liebevoll eingerichtetes Museum. Der Name „Ghibli“ leitet sich dabei von der arabischen Bezeichnung für einen heißen Wüstenwind in der Sahara ab. Miyazaki wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Ghibli einen frischen Wind in die Anime-Industrie bringen sollte, da er jene als zu einfallslos ansah.
Einen weiteren wichtigen Entwicklungsschub erlebte das Medium in den 1970ern mit Serien wie Space Battleship Yamato und Mobile Suit Gundam. Zu dieser Zeit entwickelten die Genres eine größere Bandbreite, die in Tōkyō stattfindende Manga-Messe Comiket wurde ins Leben gerufen und es traten auch die ersten Cosplayer in Erscheinung. Viele Studios verzichteten darauf, abendfüllende Trickfilme zu produzieren, da sich die Serien als das lukrativere Geschäft erwiesen. Diese Erfahrung mussten auch Takahata Isao und Miyazaki Hayao machen, die sich zunächst bei Tōei kennenlernten und 1968 mit dem Film Taiyō no Ōji: Horusu no Daibōken (Der Prinz der Sonne: Das große Abenteuer des Horus) grandios an den Kinokassen floppten. Es ist ein großes Glück, dass die beiden sich davon nicht aus der Bahn werfen ließen. Nachdem sie unter anderem an Heidi (1974) mitgearbeitet hatten, das damals ein Teil des World Masterpiece Theater war – ein Projekt, für welches bekannte Geschichten aus aller Welt als Anime-Versionen umgesetzt wurden – gründeten sie 1985, nach dem Erfolg von Nausicaä aus dem Tal der Winde (1984), das Studio Ghibli. Ghibli ist heute eines der erfolgreichsten und beliebtesten Studios und besitzt in Mitaka, einer Stadt westlich von Tōkyō, sogar sein eigenes kleines und liebevoll eingerichtetes Museum. Der Name „Ghibli“ leitet sich dabei von der arabischen Bezeichnung für einen heißen Wüstenwind in der Sahara ab. Miyazaki wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Ghibli einen frischen Wind in die Anime-Industrie bringen sollte, da er jene als zu einfallslos ansah.
„Disney belügt Kinder“
 Betrachtet man den Erfolg des Studio Ghibli, kann man Miyazakis Vorhaben zweifellos als geglückt werten. In Japan längst erfolgreich, erreichte man nach einem mit Disney geschlossenen Vertriebsdeal mit Filmen wie Prinzessin Mononoke (1997) und Chihiros Reise ins Zauberland (2001), das mit dem Goldenen Bären und dem Oscar ausgezeichnet wurde, schließlich auch internationales Renommee. Während Takahata sich auf Filme mit realistischen Settings konzentrierte, entwarf Miyazaki Fantasy-Welten, in denen die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt häufig eine große Rolle spielt. Konflikte werden mit einem hohen Grad an Komplexität dargestellt und bei ihren Lösungen setzt Miyazaki auf psychologischen Realismus: Die Figuren müssen ihre Ängste und anderen negativen Emotionen überwinden, um schwierige Situationen zu meistern. Trotz der Kooperation der beiden Firmen erklärte Miyazaki 2003 in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel frank und frei, dass Disney Kinder belüge, wenn es komplexe Sachverhalte zu einfach und beschönigend darstelle. Ein durchaus eindrucksvolles Beispiel für einen gesellschaftskritischen Kommentar nach Miyazaki-Art ist die Figur Kaonashi („Ohngesicht“ in der deutschen Fassung), die sich in Chihiros Reise ins Zauberland findet: Dieses Wesen, das anstelle eines Gesichts lediglich eine weiße Maske trägt, lockt die Menschen mit Gold, um sie daraufhin zu verschlingen. Laut Miyazaki ist diese Figur als Kritik an der modernen Konsumgesellschaft zu verstehen: Japan hätte vor lauter Materialismus seine Kultur vergessen und darüber das eigene Gesicht verloren.
Betrachtet man den Erfolg des Studio Ghibli, kann man Miyazakis Vorhaben zweifellos als geglückt werten. In Japan längst erfolgreich, erreichte man nach einem mit Disney geschlossenen Vertriebsdeal mit Filmen wie Prinzessin Mononoke (1997) und Chihiros Reise ins Zauberland (2001), das mit dem Goldenen Bären und dem Oscar ausgezeichnet wurde, schließlich auch internationales Renommee. Während Takahata sich auf Filme mit realistischen Settings konzentrierte, entwarf Miyazaki Fantasy-Welten, in denen die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt häufig eine große Rolle spielt. Konflikte werden mit einem hohen Grad an Komplexität dargestellt und bei ihren Lösungen setzt Miyazaki auf psychologischen Realismus: Die Figuren müssen ihre Ängste und anderen negativen Emotionen überwinden, um schwierige Situationen zu meistern. Trotz der Kooperation der beiden Firmen erklärte Miyazaki 2003 in einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel frank und frei, dass Disney Kinder belüge, wenn es komplexe Sachverhalte zu einfach und beschönigend darstelle. Ein durchaus eindrucksvolles Beispiel für einen gesellschaftskritischen Kommentar nach Miyazaki-Art ist die Figur Kaonashi („Ohngesicht“ in der deutschen Fassung), die sich in Chihiros Reise ins Zauberland findet: Dieses Wesen, das anstelle eines Gesichts lediglich eine weiße Maske trägt, lockt die Menschen mit Gold, um sie daraufhin zu verschlingen. Laut Miyazaki ist diese Figur als Kritik an der modernen Konsumgesellschaft zu verstehen: Japan hätte vor lauter Materialismus seine Kultur vergessen und darüber das eigene Gesicht verloren.
Prägung des Japanbildes
 Die 1980er und 1990er Jahre brachten aber auch eine Reihe von Veröffentlichungen mit sich, die das Japan- und Animebild im Ausland stark prägen sollten. Allen voran die dystopischen und häufig als postmodern angesehenen Werke Akira (1988) von Ōtomo Katsuhiro und Ghost in the Shell (1995) von Oshii Mamoru, die sich unter anderem mit Fragen nach Subjektivität und der Entfremdung des Menschen durch technologischen Fortschritt beschäftigen, schlugen im Ausland hohe Wellen. Japan galt aufgrund seiner technologischen Fortschrittlichkeit und ökonomischen Stärke seit den 1970ern vor allem in Amerika als Modell der Zukunft. Bücher, die sich mit Mentalitätsunterschieden und japanischen Arbeitsmethoden befassten, entwickelten sich in jener Zeit zu Bestsellern. Auch amerikanische Filme reflektieren dies: In Blade Runner (1982) etwa irren die Protagonisten zwischen riesigen Wolkenkratzern umher, während die heruntergekommenen Straßen von einem trüben Neonlicht beleuchtet werden. War Japan das Modell der Zukunft, so stellte Tōkyō bzw. dessen Rotlichtviertel Kabukichō folgerichtig die Inspiration für die dazu passende Szenerie. Diese Auffassung änderte sich jedoch, je weiter die 1990er fortschritten. Japan wurde zu dieser Zeit gleich von mehreren Katastrophen heimgesucht: dem Platzen der Bubble Economy zu Anfang des Jahrzehnts, gefolgt von dem großen Hanshin-Erdbeben und den Giftgasanschlägen auf die U-Bahn von Tōkyō im Jahr 1995. Sie holten das Land, das jahrzehntelang nur Wirtschaftswachstum und außen- wie innenpolitische Stabilität gekannt hatte, jäh auf den Boden der Tatsachen zurück.
Die 1980er und 1990er Jahre brachten aber auch eine Reihe von Veröffentlichungen mit sich, die das Japan- und Animebild im Ausland stark prägen sollten. Allen voran die dystopischen und häufig als postmodern angesehenen Werke Akira (1988) von Ōtomo Katsuhiro und Ghost in the Shell (1995) von Oshii Mamoru, die sich unter anderem mit Fragen nach Subjektivität und der Entfremdung des Menschen durch technologischen Fortschritt beschäftigen, schlugen im Ausland hohe Wellen. Japan galt aufgrund seiner technologischen Fortschrittlichkeit und ökonomischen Stärke seit den 1970ern vor allem in Amerika als Modell der Zukunft. Bücher, die sich mit Mentalitätsunterschieden und japanischen Arbeitsmethoden befassten, entwickelten sich in jener Zeit zu Bestsellern. Auch amerikanische Filme reflektieren dies: In Blade Runner (1982) etwa irren die Protagonisten zwischen riesigen Wolkenkratzern umher, während die heruntergekommenen Straßen von einem trüben Neonlicht beleuchtet werden. War Japan das Modell der Zukunft, so stellte Tōkyō bzw. dessen Rotlichtviertel Kabukichō folgerichtig die Inspiration für die dazu passende Szenerie. Diese Auffassung änderte sich jedoch, je weiter die 1990er fortschritten. Japan wurde zu dieser Zeit gleich von mehreren Katastrophen heimgesucht: dem Platzen der Bubble Economy zu Anfang des Jahrzehnts, gefolgt von dem großen Hanshin-Erdbeben und den Giftgasanschlägen auf die U-Bahn von Tōkyō im Jahr 1995. Sie holten das Land, das jahrzehntelang nur Wirtschaftswachstum und außen- wie innenpolitische Stabilität gekannt hatte, jäh auf den Boden der Tatsachen zurück.
Medien als Sündenböcke der Gesellschaft
 Für die Anime stellten vor allem die Giftgasanschläge mit ihren 13 Todesopfern und mehreren tausend Geschädigten einen tiefen Einschnitt dar. Die verantwortliche Sekte namens Ōmu Shinrikyō hatte ihre Mitglieder auch über eigens produzierte Anime und Manga geworben und manche ihrer Untergangsphantasien schienen von den Apokalypse-Szenarien populärer Serien, darunter auch Space Battleship Yamato, befeuert worden zu sein. Wie schon bei den Mordfällen des Miyazaki Tsutomu, der von 1988 bis 1989 mehrere junge Mädchen umgebracht hatte und deswegen 2008 hingerichtet wurde, gerieten die Medien samt ihrer Fans in Verruf. Gerade diejenigen, die sich ausgiebig mit ihrem Hobby befassten, wurden zum Inbegriff dessen, was mit der japanischen Jugend nicht stimmte: Diese sei zu egozentrisch, zu materialistisch, nicht ambitioniert genug. Der in Japan für exzessive Fans gebräuchliche Begriff „Otaku“ hat sich inzwischen auch im Westen etabliert, wo er von manchen Anime-, Manga- und Videospiel-Fans als positive Selbstbezeichnung aufgegriffen wurde. Als Otaku kann dabei in Japan aber jeder bezeichnet werden, der mit einem außergewöhnlich hohen Aufwand einem Hobby nachgeht. Dieses muss nicht notwendigerweise mit Anime und Manga zusammenhängen. Der Begriff selbst kam in den 1980er Jahren in Umlauf und ist eine übertrieben höfliche Anrede, die für Außenstehende gestelzt wirken mag, zumal wenn sie von jungen Menschen untereinander benutzt wird. Sie bedeutet im wörtlichen Sinne etwa so viel wie „dein/Ihr Haus“.
Für die Anime stellten vor allem die Giftgasanschläge mit ihren 13 Todesopfern und mehreren tausend Geschädigten einen tiefen Einschnitt dar. Die verantwortliche Sekte namens Ōmu Shinrikyō hatte ihre Mitglieder auch über eigens produzierte Anime und Manga geworben und manche ihrer Untergangsphantasien schienen von den Apokalypse-Szenarien populärer Serien, darunter auch Space Battleship Yamato, befeuert worden zu sein. Wie schon bei den Mordfällen des Miyazaki Tsutomu, der von 1988 bis 1989 mehrere junge Mädchen umgebracht hatte und deswegen 2008 hingerichtet wurde, gerieten die Medien samt ihrer Fans in Verruf. Gerade diejenigen, die sich ausgiebig mit ihrem Hobby befassten, wurden zum Inbegriff dessen, was mit der japanischen Jugend nicht stimmte: Diese sei zu egozentrisch, zu materialistisch, nicht ambitioniert genug. Der in Japan für exzessive Fans gebräuchliche Begriff „Otaku“ hat sich inzwischen auch im Westen etabliert, wo er von manchen Anime-, Manga- und Videospiel-Fans als positive Selbstbezeichnung aufgegriffen wurde. Als Otaku kann dabei in Japan aber jeder bezeichnet werden, der mit einem außergewöhnlich hohen Aufwand einem Hobby nachgeht. Dieses muss nicht notwendigerweise mit Anime und Manga zusammenhängen. Der Begriff selbst kam in den 1980er Jahren in Umlauf und ist eine übertrieben höfliche Anrede, die für Außenstehende gestelzt wirken mag, zumal wenn sie von jungen Menschen untereinander benutzt wird. Sie bedeutet im wörtlichen Sinne etwa so viel wie „dein/Ihr Haus“.
Eine Subkultur wehrt sich
 In die Zeit der schlechten Berichterstattung fällt auch die Serie Neon Genesis Evangelion (1995-1996), die von Studio Gainax produziert wurde und einen ebensolchen schüchternen und ziellosen jungen Protagonisten in den Mittelpunkt ihrer Handlung stellt, wie ihn die Medien als Archetyp des japanischen Jugendlichen skizzierten. Die Gründer von Studio Gainax waren selbst Otaku und hatten bereits Anfang der 90er Jahre mit Otaku no Video (Otaku-Video/dein Video) versucht, ihre Passion gewürzt mit einer Prise Ironie einem breiteren Publikum verständlich zu machen. Der massive nationale wie internationale Erfolg von Evangelion, dessen letzte Folge in Japan von mehr als zehn Millionen Menschen im Fernsehen gesehen wurde, wie auch die Anerkennung der Studio-Ghibli-Produktionen im Ausland dürften dazu beigetragen haben, Manga und Anime mitsamt ihren Fans ein wenig zu rehabilitieren. Führende Köpfe dieser Subkultur wie Okada Toshio von Gainax oder der Kritiker und Schriftsteller Ōtsuka Eiji schalteten sich immer wieder in die Debatte ein, um ihr Hobby zu verteidigen. Ein weiterer Meilenstein diesbezüglich war auch die Ausstrahlung der Drama-Serie Densha Otoko (Der Bahnmann) von 2005, die einen Otaku als Protagonisten zeigt, der einer sexuell belästigten Frau zu Hilfe kommt. Die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basieren soll, entfachte einen Hype und bot dem Zuschauer viele Identifikationsmöglichkeiten an. Inzwischen haben auch japanische Politiker und die Wirtschaft das Potential von Anime und Manga erkannt: Unter dem Motto „Cool Japan“ werden die Medien heutzutage auch benutzt, um ein positives Image von Japan im Ausland zu zeichnen.
In die Zeit der schlechten Berichterstattung fällt auch die Serie Neon Genesis Evangelion (1995-1996), die von Studio Gainax produziert wurde und einen ebensolchen schüchternen und ziellosen jungen Protagonisten in den Mittelpunkt ihrer Handlung stellt, wie ihn die Medien als Archetyp des japanischen Jugendlichen skizzierten. Die Gründer von Studio Gainax waren selbst Otaku und hatten bereits Anfang der 90er Jahre mit Otaku no Video (Otaku-Video/dein Video) versucht, ihre Passion gewürzt mit einer Prise Ironie einem breiteren Publikum verständlich zu machen. Der massive nationale wie internationale Erfolg von Evangelion, dessen letzte Folge in Japan von mehr als zehn Millionen Menschen im Fernsehen gesehen wurde, wie auch die Anerkennung der Studio-Ghibli-Produktionen im Ausland dürften dazu beigetragen haben, Manga und Anime mitsamt ihren Fans ein wenig zu rehabilitieren. Führende Köpfe dieser Subkultur wie Okada Toshio von Gainax oder der Kritiker und Schriftsteller Ōtsuka Eiji schalteten sich immer wieder in die Debatte ein, um ihr Hobby zu verteidigen. Ein weiterer Meilenstein diesbezüglich war auch die Ausstrahlung der Drama-Serie Densha Otoko (Der Bahnmann) von 2005, die einen Otaku als Protagonisten zeigt, der einer sexuell belästigten Frau zu Hilfe kommt. Die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basieren soll, entfachte einen Hype und bot dem Zuschauer viele Identifikationsmöglichkeiten an. Inzwischen haben auch japanische Politiker und die Wirtschaft das Potential von Anime und Manga erkannt: Unter dem Motto „Cool Japan“ werden die Medien heutzutage auch benutzt, um ein positives Image von Japan im Ausland zu zeichnen.
Geschrieben von Daniel Büscher