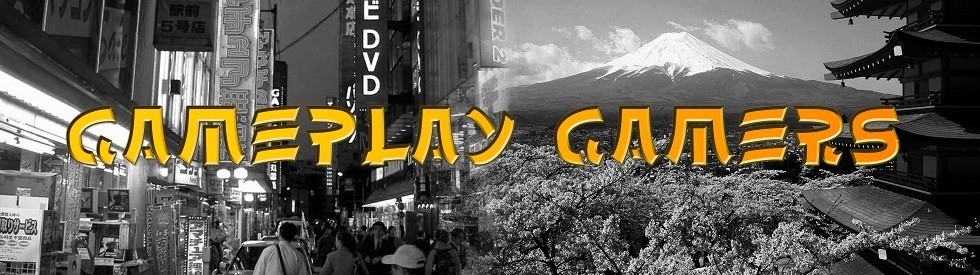Die Französische Revolution ist eine der komplexesten und vielschichtigsten Themenkomplexe, derer sich ein Filmemacher annehmen kann. Seitdem die Bilder laufen lernten, haben sich viele Kreative an der Darstellung davon oder an verschiedenen Einzelaspekten versucht, insbesondere in den USA und selbstverständlich in Frankreich.
Die Französische Revolution ist eine der komplexesten und vielschichtigsten Themenkomplexe, derer sich ein Filmemacher annehmen kann. Seitdem die Bilder laufen lernten, haben sich viele Kreative an der Darstellung davon oder an verschiedenen Einzelaspekten versucht, insbesondere in den USA und selbstverständlich in Frankreich.
 Ich beginne mit einer steilen These: Die Französische Revolution ist im Bereich von Film und Fernsehen nicht annährend so populär wie die schillernde Porträtierung von hochgestellten Persönlichkeiten dieser Periode wie Marie Antoinette oder Napoleon, zumal die revolutionären Verhältnisse, die uns in Film- und Fernsehform schließlich präsentiert werden, ausgerechnet den Großteil jener komplexen Ent- und Verwicklungen der immensen, weittragenden politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen großzügig vorenthalten. Stattdessen beschränken sich Filmemacher auffällig häufig auf das effekthascherische Drama der Herrschaft des Terrors, genauer der Jakobinerherrschaft von 1793 bis 1794. Blut, Gewalt, Fanatismus als Spektakel gewürzt mit einer gesunden Dosis Skepsis an Mob-Mentalität und Totalitarismus sollen das Publikum reizen, nicht aber der passionierte Kampf für die eigenen Rechte und Freiheiten oder das gerechtfertigte Aufbegehren gegen eine dekadente wie selbstgefällige Oberschicht. Fast scheint es, als solle lieber die Skepsis am Freiheitskampf geweckt werden, als den durchaus hehren, in manchen Belangen zweifellos utopischen Bestrebungen und Idealen der bourgeoisen Vordenker Raum zu geben. Dabei wäre gerade die Erkenntnis, dass das Feuer eines gerechten Kampfes schwer zu zügeln ist und in ochlokratischen Verhältnissen oder im Fanatismus außer Kontrolle geraten kann, ein bedeutsamer Schritt in der Anerkennung massenpsychologischer Effekte und soziopolitischer Dynamiken, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, anstatt sie unreflektiert zu verdammen – gerade in heutiger Zeit.
Ich beginne mit einer steilen These: Die Französische Revolution ist im Bereich von Film und Fernsehen nicht annährend so populär wie die schillernde Porträtierung von hochgestellten Persönlichkeiten dieser Periode wie Marie Antoinette oder Napoleon, zumal die revolutionären Verhältnisse, die uns in Film- und Fernsehform schließlich präsentiert werden, ausgerechnet den Großteil jener komplexen Ent- und Verwicklungen der immensen, weittragenden politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen großzügig vorenthalten. Stattdessen beschränken sich Filmemacher auffällig häufig auf das effekthascherische Drama der Herrschaft des Terrors, genauer der Jakobinerherrschaft von 1793 bis 1794. Blut, Gewalt, Fanatismus als Spektakel gewürzt mit einer gesunden Dosis Skepsis an Mob-Mentalität und Totalitarismus sollen das Publikum reizen, nicht aber der passionierte Kampf für die eigenen Rechte und Freiheiten oder das gerechtfertigte Aufbegehren gegen eine dekadente wie selbstgefällige Oberschicht. Fast scheint es, als solle lieber die Skepsis am Freiheitskampf geweckt werden, als den durchaus hehren, in manchen Belangen zweifellos utopischen Bestrebungen und Idealen der bourgeoisen Vordenker Raum zu geben. Dabei wäre gerade die Erkenntnis, dass das Feuer eines gerechten Kampfes schwer zu zügeln ist und in ochlokratischen Verhältnissen oder im Fanatismus außer Kontrolle geraten kann, ein bedeutsamer Schritt in der Anerkennung massenpsychologischer Effekte und soziopolitischer Dynamiken, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, anstatt sie unreflektiert zu verdammen – gerade in heutiger Zeit.
Was die Französische Revolution für uns heute bedeutet
 Zugegeben sind das sehr persönliche Eindrücke, ein Gefühl, keine empirisch gesicherten Tatsachen, die sich mit prägnanten Gegenbeispielen relativieren lassen mögen. Nichtsdestotrotz bleibt der Eindruck bestehen: Die Französische Revolution ist ohne Frage ein sträflich vernachlässigter Themenkomplex in der Kinosphäre, dessen randständige mediale Präsenz in keinem Verhältnis zu der gravierenden Bedeutung steht, welche die Ereignisse von 1789 bis 1799 für unsere soziopolitische Entwicklung einnehmen. Dinge wie Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung, der Meinungsäußerung, der Religion, politische Gleichheit, Pressefreiheit, Volkssouveränität, nationales Selbstbestimmungsrecht, der Schutz der Rechte von Minderheiten, nicht zu vergessen die Voranstellung der Menschenrechte, sind alles Prinzipien, die sich die Revolutionäre mühevoll im erbitterten Kampf gegen das Ancien Régime erstritten haben. Diese Prinzipien sind zu den Leitsätzen moderner Demokratien geworden. Obwohl sie bis heute ihre Gültigkeit beibehalten konnten, standen sie immer wieder unter Beschuss durch reaktionären Kräfte – was wir heute bedauerlicherweise verstärkt miterleben, wo autoritäre Tendenzen und Nationalismen weltweit an Boden gewinnen, dabei von nichts mehr profitieren als Geschichtsvergessenheit. Dabei sind diese Grundsätze beileibe keine Lappalien, keine beiläufigen Errungenschaften, deren Selbstverständlichkeit wir uns bloß, weil wir es gewohnt sind, im Privileg ihrer Schirmherrschaft zu leben, noch lange nicht sicher sein können. Insofern ist es bedenklich, dass einer der größten revolutionären Kraftakte, der für uns alle diese Errungenschaften unter vielen Opfern erkämpft hat, momentan in einer derartigen medialen Marginalisierung vor sich hin darbt.
Zugegeben sind das sehr persönliche Eindrücke, ein Gefühl, keine empirisch gesicherten Tatsachen, die sich mit prägnanten Gegenbeispielen relativieren lassen mögen. Nichtsdestotrotz bleibt der Eindruck bestehen: Die Französische Revolution ist ohne Frage ein sträflich vernachlässigter Themenkomplex in der Kinosphäre, dessen randständige mediale Präsenz in keinem Verhältnis zu der gravierenden Bedeutung steht, welche die Ereignisse von 1789 bis 1799 für unsere soziopolitische Entwicklung einnehmen. Dinge wie Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung, der Meinungsäußerung, der Religion, politische Gleichheit, Pressefreiheit, Volkssouveränität, nationales Selbstbestimmungsrecht, der Schutz der Rechte von Minderheiten, nicht zu vergessen die Voranstellung der Menschenrechte, sind alles Prinzipien, die sich die Revolutionäre mühevoll im erbitterten Kampf gegen das Ancien Régime erstritten haben. Diese Prinzipien sind zu den Leitsätzen moderner Demokratien geworden. Obwohl sie bis heute ihre Gültigkeit beibehalten konnten, standen sie immer wieder unter Beschuss durch reaktionären Kräfte – was wir heute bedauerlicherweise verstärkt miterleben, wo autoritäre Tendenzen und Nationalismen weltweit an Boden gewinnen, dabei von nichts mehr profitieren als Geschichtsvergessenheit. Dabei sind diese Grundsätze beileibe keine Lappalien, keine beiläufigen Errungenschaften, deren Selbstverständlichkeit wir uns bloß, weil wir es gewohnt sind, im Privileg ihrer Schirmherrschaft zu leben, noch lange nicht sicher sein können. Insofern ist es bedenklich, dass einer der größten revolutionären Kraftakte, der für uns alle diese Errungenschaften unter vielen Opfern erkämpft hat, momentan in einer derartigen medialen Marginalisierung vor sich hin darbt.
Erste Schritte
 Seit der rapiden Entwicklung der Filmindustrie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben freilich zunächst verschiedene Filmemacher unterschiedlichster Länder die Französische Revolution thematisiert. Vielfach nahmen sie sich beliebte Theaterstücke oder Romane zur Vorlage, etwa Adolphe d’Ennerys und Eugène Cormons Les deux orphelines oder Charles John Huffam Dickens Eine Geschichte aus zwei Städten. Einer der ersten Filme war Jean Alexandre Louis Promios und Georges Alphonse Hatots 1897 für die Société Lumière entstandene Mort de Marat, visuell an Jacques-Louis Davids Gemälde Der Tod des Marat von 1793 angelehnt. Seit dieser Pionierleistung sind je nach Zählung gut 300 Spielfilme zustande gekommen, zusätzlich zu diversen Fernsehserien, Kurzfilmen oder Dokumentationen. Mehr als die Hälfte stammt wenig überraschend aus Frankreich. Daneben existiert eine große Zahl Produktionen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Italien, hinzukommend der eine oder andere Beitrag aus Polen, Spanien, Japan und anderen Ländern. 1904 erschien mit dem Kurzfilm Marie-Antoinette der erste US-amerikanische Stummfilm zum Thema. 1910 bis 1919 gab es die meisten Veröffentlichungen von Revolutionsfilmen in den Staaten und noch bis in die 1950er-Jahre wurden fleißig weitere Werke produziert. Aus dieser Zeit stechen David Wark Griffiths moralisierendes Revolutionsdrama Zwei Waisen im Sturm von 1921, das schwülstige, opulente Kostümmelodrama Marie Antoinette von Woodbridge Strong Van Dyke II aus dem Jahre 1938, sowie Anthony Manns Historien-Film-noir Guillotine von 1949 hervor.
Seit der rapiden Entwicklung der Filmindustrie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben freilich zunächst verschiedene Filmemacher unterschiedlichster Länder die Französische Revolution thematisiert. Vielfach nahmen sie sich beliebte Theaterstücke oder Romane zur Vorlage, etwa Adolphe d’Ennerys und Eugène Cormons Les deux orphelines oder Charles John Huffam Dickens Eine Geschichte aus zwei Städten. Einer der ersten Filme war Jean Alexandre Louis Promios und Georges Alphonse Hatots 1897 für die Société Lumière entstandene Mort de Marat, visuell an Jacques-Louis Davids Gemälde Der Tod des Marat von 1793 angelehnt. Seit dieser Pionierleistung sind je nach Zählung gut 300 Spielfilme zustande gekommen, zusätzlich zu diversen Fernsehserien, Kurzfilmen oder Dokumentationen. Mehr als die Hälfte stammt wenig überraschend aus Frankreich. Daneben existiert eine große Zahl Produktionen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Italien, hinzukommend der eine oder andere Beitrag aus Polen, Spanien, Japan und anderen Ländern. 1904 erschien mit dem Kurzfilm Marie-Antoinette der erste US-amerikanische Stummfilm zum Thema. 1910 bis 1919 gab es die meisten Veröffentlichungen von Revolutionsfilmen in den Staaten und noch bis in die 1950er-Jahre wurden fleißig weitere Werke produziert. Aus dieser Zeit stechen David Wark Griffiths moralisierendes Revolutionsdrama Zwei Waisen im Sturm von 1921, das schwülstige, opulente Kostümmelodrama Marie Antoinette von Woodbridge Strong Van Dyke II aus dem Jahre 1938, sowie Anthony Manns Historien-Film-noir Guillotine von 1949 hervor.
Hollywood verliert das Interesse
 Seit den 1960er-Jahern ebbte das Interesse Hollywoods an der Französischen Revolution erheblich mit Tendenz zu null ab. 1970 und 1980 brachten jeweils eine Komödie mit Anknüpfpunkten hervor: Alan David „Bud“ Yorkins Die Französische Revolution fand nicht statt mit Gene Wilder und Donald McNicol Sutherland; außerdem Mel Brooks Historienschinkenparodie Mel Brooks‘ verrückte Geschichte der Welt, worin die Revolution in lediglich einer Episode eine Rolle spielt. 1995 inszenierte James Francis Ivory mit überschaubarem Budget Jefferson in Paris. 2006 drehte Sofia Carmina Coppola Marie Antoinette mit Kirsten Caroline Dunst in der Hauptrolle, welcher aus der Erzherzogin und Königin ein It-Girl, ja, regelrecht eine Pop-Ikone machte – und dafür sattsam Schelte einstecken musste. Später entstandene Filme wie Stephen Williams Chevalier von 2022 und Ridley Scotts Napoleon von 2023 streiften die revolutionären Stationen ihrer Protagonisten nur noch am Rande, verliehen ihnen darüber hinaus hingegen kaum Substanz. Gerade den US-amerikanischen Produktionen ist eine ausgeprägte dichterische Freiheit im Sinne filmischer Konstruiertheit zu eigen. Ein Film wie Marie Antoinette von 1938 stellt sich in erster Linie als publikumstaugliche Melodramunterhaltung heraus, der mehr an prächtigen Kostümen, denn an Historizität gelegen ist. Zwei Waisen im Sturm wiederum opfert, trotz einiger beeindruckender Massenszenen und beachtlichem Willen zu Authentizität, wie bei Griffith üblich Glaubwürdigkeit packender Dramaturgie und mitreißender Montage. Nirgends wird dies deutlicher als in der Szene, wenn Georges Jacques Danton, der „Abraham Lincoln Frankreichs“, auf einem weißen Ross in einer dramatischen Parallelmontage herangeprescht kommt, um die blinde Protagonistin um Haaresbreite vor der Guillotine zu bewahren. Zu guter Letzt gewinnt sie gemeinsam mit ihrer Schwester die Gunst des Volkes und sogar ihr Augenlicht zurück. Ein Happy End auf dem Schafott. Typisch Hollywood bleibt zu sagen.
Seit den 1960er-Jahern ebbte das Interesse Hollywoods an der Französischen Revolution erheblich mit Tendenz zu null ab. 1970 und 1980 brachten jeweils eine Komödie mit Anknüpfpunkten hervor: Alan David „Bud“ Yorkins Die Französische Revolution fand nicht statt mit Gene Wilder und Donald McNicol Sutherland; außerdem Mel Brooks Historienschinkenparodie Mel Brooks‘ verrückte Geschichte der Welt, worin die Revolution in lediglich einer Episode eine Rolle spielt. 1995 inszenierte James Francis Ivory mit überschaubarem Budget Jefferson in Paris. 2006 drehte Sofia Carmina Coppola Marie Antoinette mit Kirsten Caroline Dunst in der Hauptrolle, welcher aus der Erzherzogin und Königin ein It-Girl, ja, regelrecht eine Pop-Ikone machte – und dafür sattsam Schelte einstecken musste. Später entstandene Filme wie Stephen Williams Chevalier von 2022 und Ridley Scotts Napoleon von 2023 streiften die revolutionären Stationen ihrer Protagonisten nur noch am Rande, verliehen ihnen darüber hinaus hingegen kaum Substanz. Gerade den US-amerikanischen Produktionen ist eine ausgeprägte dichterische Freiheit im Sinne filmischer Konstruiertheit zu eigen. Ein Film wie Marie Antoinette von 1938 stellt sich in erster Linie als publikumstaugliche Melodramunterhaltung heraus, der mehr an prächtigen Kostümen, denn an Historizität gelegen ist. Zwei Waisen im Sturm wiederum opfert, trotz einiger beeindruckender Massenszenen und beachtlichem Willen zu Authentizität, wie bei Griffith üblich Glaubwürdigkeit packender Dramaturgie und mitreißender Montage. Nirgends wird dies deutlicher als in der Szene, wenn Georges Jacques Danton, der „Abraham Lincoln Frankreichs“, auf einem weißen Ross in einer dramatischen Parallelmontage herangeprescht kommt, um die blinde Protagonistin um Haaresbreite vor der Guillotine zu bewahren. Zu guter Letzt gewinnt sie gemeinsam mit ihrer Schwester die Gunst des Volkes und sogar ihr Augenlicht zurück. Ein Happy End auf dem Schafott. Typisch Hollywood bleibt zu sagen.
Jakobiner-Komplex und Guillotine-Fetisch
 Unübersehbar ist, dass sich insbesondere die US-amerikanischen Filmproduzenten mit Vorliebe auf die Vorstellung der „schwarzen Jakobiner“ und Bilder des Fallbeils stützten. Politische und soziale Bedingungen und Vorentwicklung waren von untergeordnetem Rang, komplexe Sachverhalte wurden runtergekürzt und frappante Schwarz-Weiß-Malerei betrieben. Mit Vorliebe wurde der rasende Mob gezeigt oder auf die autoritären Züge eines Maximilien de Robespierre verwiesen, dessen Intrigen und Machenschaften in Anthony Manns Guillotine zur unmissverständlichen Sowjetparabel umgedeutet wurden. Obwohl zwischen der Amerikanischen und der Französischen Revolution oft eine schwer zu verleugnende Verwandtschaft und Wechselwirksamkeit gesehen wird, sogar von Schwesterrepubliken die Rede ist, scheint in Hollywood die Meinung geherrscht zu haben, das französische Pendant müsse als gescheitert oder allerwenigstens in der späteren Phase fehlgeleitet hinzustellen sein, um die Großartigkeit der eigenen Revolution indirekt herauskehren zu können – ungeachtet dessen, ob diese wahrgenommene Überlegenheit einer historischen Betrachtung standhalten würde, wird die Französische Revolution filmisch in den Dienst der US-amerikanischen Meistererzählung gestellt. Insofern verwundert es nicht, dass es stets die betont in den Vordergrund gestellte, assoziativ stark aufgeladene Gestalt der Guillotine ist, die im US-amerikanischen Revolutionsfilm am häufigsten zu sehen ist. Sie wird nachgerade ostentativ nach vorne gedrängt und dem Zuschauer wenig subtil immerzu aufgezwungen. Nicht selten eröffnet eine Einstellung der niedersausenden Klinge einen Film und beschließt ihn zugleich. Ein übermächtiges und ominöses Symbol des Terrors, gleichermaßen abschreckend wie sensationslüstern.
Unübersehbar ist, dass sich insbesondere die US-amerikanischen Filmproduzenten mit Vorliebe auf die Vorstellung der „schwarzen Jakobiner“ und Bilder des Fallbeils stützten. Politische und soziale Bedingungen und Vorentwicklung waren von untergeordnetem Rang, komplexe Sachverhalte wurden runtergekürzt und frappante Schwarz-Weiß-Malerei betrieben. Mit Vorliebe wurde der rasende Mob gezeigt oder auf die autoritären Züge eines Maximilien de Robespierre verwiesen, dessen Intrigen und Machenschaften in Anthony Manns Guillotine zur unmissverständlichen Sowjetparabel umgedeutet wurden. Obwohl zwischen der Amerikanischen und der Französischen Revolution oft eine schwer zu verleugnende Verwandtschaft und Wechselwirksamkeit gesehen wird, sogar von Schwesterrepubliken die Rede ist, scheint in Hollywood die Meinung geherrscht zu haben, das französische Pendant müsse als gescheitert oder allerwenigstens in der späteren Phase fehlgeleitet hinzustellen sein, um die Großartigkeit der eigenen Revolution indirekt herauskehren zu können – ungeachtet dessen, ob diese wahrgenommene Überlegenheit einer historischen Betrachtung standhalten würde, wird die Französische Revolution filmisch in den Dienst der US-amerikanischen Meistererzählung gestellt. Insofern verwundert es nicht, dass es stets die betont in den Vordergrund gestellte, assoziativ stark aufgeladene Gestalt der Guillotine ist, die im US-amerikanischen Revolutionsfilm am häufigsten zu sehen ist. Sie wird nachgerade ostentativ nach vorne gedrängt und dem Zuschauer wenig subtil immerzu aufgezwungen. Nicht selten eröffnet eine Einstellung der niedersausenden Klinge einen Film und beschließt ihn zugleich. Ein übermächtiges und ominöses Symbol des Terrors, gleichermaßen abschreckend wie sensationslüstern.
Zurück zum Ursprung: Das französische Revolutionskino
 Das französische Kino bedient schon allein bedingt durch die enorm hohe Anzahl an Produktionen ein weitaus weiträumigeres Spektrum an revolutionären Themen, das sich um Längen nicht auf Szenerien der Schreckensherrschaft der Jakobiner und Zurschaustellung blutiger Guillotine-Bilder reduzieren lässt. Mancher Filmemacher verzichtete womöglich zur Gänze auf Schafott-Obsessionen zugunsten von differenzierten politischen oder gesellschaftlichen Anliegen, die geschichtliche Komplexitäten mal mehr und mal weniger nuanciert berücksichtigten. Dass hierbei die französische Meistererzählung, etwa wie aus den revolutionären Tumulten ein geeintes und zentralisiertes gestärktes Frankreich hervorging, wirksameren Widerhall erzeugte, ist logische Konsequenz – natürlich stets gemessen am Kontext von Entstehungszeit und Filmemacher. Je nach Schwerpunktsetzung konnte sich ebenso eine konservative oder kritische Lesung der autoritären Züge der Revolution offenbaren. Aussagekräftige Beispiele französischen Schaffens herauszupicken fällt demgemäß nicht leicht, dafür ist das Feld zu weitläufig, die Vielfalt zu breit aufgestellt. Obgleich die Revolution im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika französische Filmschaffende über einen längeren Zeitabschnitt beschäftigt hat, tatsächlich im Grunde heute noch beschäftigt, hat selbst in ihrem Heimatland die Dichte nachgelassen und sich eine verstärkte Wahrnehmung der Rolle Louis XVI. oder Marie Antoinettes in das revolutionäre Geschehen eingeschlichen.
Das französische Kino bedient schon allein bedingt durch die enorm hohe Anzahl an Produktionen ein weitaus weiträumigeres Spektrum an revolutionären Themen, das sich um Längen nicht auf Szenerien der Schreckensherrschaft der Jakobiner und Zurschaustellung blutiger Guillotine-Bilder reduzieren lässt. Mancher Filmemacher verzichtete womöglich zur Gänze auf Schafott-Obsessionen zugunsten von differenzierten politischen oder gesellschaftlichen Anliegen, die geschichtliche Komplexitäten mal mehr und mal weniger nuanciert berücksichtigten. Dass hierbei die französische Meistererzählung, etwa wie aus den revolutionären Tumulten ein geeintes und zentralisiertes gestärktes Frankreich hervorging, wirksameren Widerhall erzeugte, ist logische Konsequenz – natürlich stets gemessen am Kontext von Entstehungszeit und Filmemacher. Je nach Schwerpunktsetzung konnte sich ebenso eine konservative oder kritische Lesung der autoritären Züge der Revolution offenbaren. Aussagekräftige Beispiele französischen Schaffens herauszupicken fällt demgemäß nicht leicht, dafür ist das Feld zu weitläufig, die Vielfalt zu breit aufgestellt. Obgleich die Revolution im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika französische Filmschaffende über einen längeren Zeitabschnitt beschäftigt hat, tatsächlich im Grunde heute noch beschäftigt, hat selbst in ihrem Heimatland die Dichte nachgelassen und sich eine verstärkte Wahrnehmung der Rolle Louis XVI. oder Marie Antoinettes in das revolutionäre Geschehen eingeschlichen.
Das erste Meisterwerk und die Marseillaise
 Abel Gances epochale Napoleon-Biografie von 1927 war als erster von sechs Filmen über den legendären Korsen gedacht, realisieren vermochte der Regisseur schlussendlich bloß das erste Kapitel dieses monumentalen Vorhabens. Bereits für die Schilderung von Bonapartes frühen Jahren während der französischen Revolution veranschlagte Gance sage und schreibe fünf Stunden. Nichtsdestoweniger zählt sein Napoleon zu den großen innovativen wegweisenden Meisterwerken der Filmgeschichte. 1938 schuf Jean Renoir mit La Marseillaise ein episodisches wie erzählerisch breit angelegtes Panorama von Politik, Gesellschaft und Militär. Obwohl er sich des Öfteren in die feinen Salons von Adel und Oberschicht begibt, folgt Renoir in erster Linie drei aus Marseille stammenden Charakteren unterschiedlicher gesellschaftlicher Herkunft. Anhand ihres Schicksals werden die Ereignisse zwischen 1789 bis 1792 nachgezeichnet: Angefangen bei der Eroberung des Marseiller Fort Saint-Jean, über die Geburtsstunde der Marseillaise als Fanal der Revolution, bis hin zum blutigen Tuileriensturm am 10. August 1792 erstreckt sich ihr Werdegang. Weder Guillotine, noch Jakobinerherrschaft, nicht einmal die sich knapp einen Monat nach Ende der Filmhandlung ereignenden Septembermassaker finden hierin die kleinste den Chanson de geste trübende Erwähnung. Im Gegenteil herrscht die meiste Zeit beinahe ausgelassen-fröhliche Aufbruchsstimmung. Erst gen Ende schlägt Renoir dramatischere Töne an und mündet nichtsdestoweniger im heldenhaften Siegesmarsch seiner Recken. In einer Zeit geschaffen, in der sich Frankreich unvermeidlich auf dem Weg in den Krieg mit Deutschland befand, ist der flagrante Hang zu Patriotismus und ausgestelltem Nationalstolz unübersehbar oder viel mehr unüberhörbar: Die Marseillaise wird dem Titel gemäß zu jedem Anlass von großen Menschenmassen in leidenschaftlich-patriotischer Innbrunst avec ferveur geschmettert. Daneben indes ebenso die vorherrschende Meistererzählung des revolutionären Akts als den einer nationalen Wiedergeburt bedient, der Überwindung von regionalen und politischen Differenzen, nicht zuletzt dem allgemeingültigen Geist der Ziele und Prinzipien der Revolution und der Verbrüderung.
Abel Gances epochale Napoleon-Biografie von 1927 war als erster von sechs Filmen über den legendären Korsen gedacht, realisieren vermochte der Regisseur schlussendlich bloß das erste Kapitel dieses monumentalen Vorhabens. Bereits für die Schilderung von Bonapartes frühen Jahren während der französischen Revolution veranschlagte Gance sage und schreibe fünf Stunden. Nichtsdestoweniger zählt sein Napoleon zu den großen innovativen wegweisenden Meisterwerken der Filmgeschichte. 1938 schuf Jean Renoir mit La Marseillaise ein episodisches wie erzählerisch breit angelegtes Panorama von Politik, Gesellschaft und Militär. Obwohl er sich des Öfteren in die feinen Salons von Adel und Oberschicht begibt, folgt Renoir in erster Linie drei aus Marseille stammenden Charakteren unterschiedlicher gesellschaftlicher Herkunft. Anhand ihres Schicksals werden die Ereignisse zwischen 1789 bis 1792 nachgezeichnet: Angefangen bei der Eroberung des Marseiller Fort Saint-Jean, über die Geburtsstunde der Marseillaise als Fanal der Revolution, bis hin zum blutigen Tuileriensturm am 10. August 1792 erstreckt sich ihr Werdegang. Weder Guillotine, noch Jakobinerherrschaft, nicht einmal die sich knapp einen Monat nach Ende der Filmhandlung ereignenden Septembermassaker finden hierin die kleinste den Chanson de geste trübende Erwähnung. Im Gegenteil herrscht die meiste Zeit beinahe ausgelassen-fröhliche Aufbruchsstimmung. Erst gen Ende schlägt Renoir dramatischere Töne an und mündet nichtsdestoweniger im heldenhaften Siegesmarsch seiner Recken. In einer Zeit geschaffen, in der sich Frankreich unvermeidlich auf dem Weg in den Krieg mit Deutschland befand, ist der flagrante Hang zu Patriotismus und ausgestelltem Nationalstolz unübersehbar oder viel mehr unüberhörbar: Die Marseillaise wird dem Titel gemäß zu jedem Anlass von großen Menschenmassen in leidenschaftlich-patriotischer Innbrunst avec ferveur geschmettert. Daneben indes ebenso die vorherrschende Meistererzählung des revolutionären Akts als den einer nationalen Wiedergeburt bedient, der Überwindung von regionalen und politischen Differenzen, nicht zuletzt dem allgemeingültigen Geist der Ziele und Prinzipien der Revolution und der Verbrüderung.
Ein anderer Blickwinkel
 1947 beleuchtete Henrif Calef in seinem auf Honoré de Balzacs basierenden Melodrama Les Chouans die andere Seite, nämlich die der Chouannerie, königstreuer Katholiken aus der Bretagne, die von 1792 bis circa 1804 der Jakobinerregierung bewaffneten Widerstand leisteten. So kurz nach Kriegsende muss es Calef naheliegend erschienen sein, überdeutlich Parallelen zwischen den Chouans und der Résistance zu ziehen, um dem Widerstand gegen autoritäre Macht wie das Vichy-Regime, ein Denkmal zu setzen – ungeachtet dessen, dass die Chouans ideologisch anders gelagert waren. Wie sehr sich Bearbeitungsweisen solcher Sujets unterscheiden können, zeigt Philippe Claude Alex de Broca de Ferrussacs 1988 veröffentlichte Neuverfilmung. Wie der Titel Chouans! – Revolution und Leidenschaft bereits andeutet, handelt es sich bei de Broca im Gegensatz zu Calef um einen unterhaltsamem Abenteuerfilm, in seiner Darstellung romantisch, bildgewaltig, mit den Chouans in der Rolle der edlen Rebellen, die fast wie Robin-Hood-artige Figuren wirken. Noch in den 1950er-Jahren hatte Alexandre-Pierre Georges „Sacha“ Guitry mit seiner Tableaux-Trilogie Wenn Versailles erzählen könnte von 1954, Napoleon von 1955 und Si Paris nous était conté von 1956 einen Streifzug durch die französische Geschichte begangen, der zwangsläufig einige Episoden der Revolutionen beinhaltete. Allgemein waren in den 1950er- und 1960er-Jahren französisch-italienische Koproduktionen marktführend auf dem Feld der Revolutionsfilme, bei denen sich indessen vielfach ein Hang zu Mantel-und-Degen-Kintopp bemerkbar machte und deren Augenmerk auf Abenteuer und Action, nicht auf ideologischen oder sozialen Dimensionen der Revolution ruhte.
1947 beleuchtete Henrif Calef in seinem auf Honoré de Balzacs basierenden Melodrama Les Chouans die andere Seite, nämlich die der Chouannerie, königstreuer Katholiken aus der Bretagne, die von 1792 bis circa 1804 der Jakobinerregierung bewaffneten Widerstand leisteten. So kurz nach Kriegsende muss es Calef naheliegend erschienen sein, überdeutlich Parallelen zwischen den Chouans und der Résistance zu ziehen, um dem Widerstand gegen autoritäre Macht wie das Vichy-Regime, ein Denkmal zu setzen – ungeachtet dessen, dass die Chouans ideologisch anders gelagert waren. Wie sehr sich Bearbeitungsweisen solcher Sujets unterscheiden können, zeigt Philippe Claude Alex de Broca de Ferrussacs 1988 veröffentlichte Neuverfilmung. Wie der Titel Chouans! – Revolution und Leidenschaft bereits andeutet, handelt es sich bei de Broca im Gegensatz zu Calef um einen unterhaltsamem Abenteuerfilm, in seiner Darstellung romantisch, bildgewaltig, mit den Chouans in der Rolle der edlen Rebellen, die fast wie Robin-Hood-artige Figuren wirken. Noch in den 1950er-Jahren hatte Alexandre-Pierre Georges „Sacha“ Guitry mit seiner Tableaux-Trilogie Wenn Versailles erzählen könnte von 1954, Napoleon von 1955 und Si Paris nous était conté von 1956 einen Streifzug durch die französische Geschichte begangen, der zwangsläufig einige Episoden der Revolutionen beinhaltete. Allgemein waren in den 1950er- und 1960er-Jahren französisch-italienische Koproduktionen marktführend auf dem Feld der Revolutionsfilme, bei denen sich indessen vielfach ein Hang zu Mantel-und-Degen-Kintopp bemerkbar machte und deren Augenmerk auf Abenteuer und Action, nicht auf ideologischen oder sozialen Dimensionen der Revolution ruhte.
Zeit des Umbruchs
 Die 1980er-Jahre bedeuteten für Frankreich eine Zeit des Umbruchs: François Mitterrand wurde 1981 der erste sozialistische Präsident seit Jahrzehnten, während kulturell eine Neuentdeckung der „großen französischen Geschichte“ einsetzte. Damit ist keine ideologisch geprägte Ausrichtung gemäß der 1950er-Jahre gemeint, sondern so etwas wie ein postmoderner Bilderkosmos, der sich oftmals als ambivalent oder nostalgisch aufgeladen erwies. In diesem Kontext erfuhr die Revolution eine Umdeutung weg vom Bild des progressiven, heroischen Ideals, hin zu einem emotional und psychologisch aufgeladenen Trauma – oder alternativ zu einer romantisierten Kulisse. Klassische Monarchisten und Royalisten war selten die Heldenrolle vergönnt. Dafür häuften sich diejenigen Figuren, die für eine verlorene Ordnung, eine persönliche Bindung zur Welt kämpften. Es wurden Kostümfilme mit Blockbuster-Anspruch herausgebracht. Dennoch war Ambivalenz statt Parteinahme vorherrschend und der französische Filmemacher darum bedacht, beide Seiten zu zeigen, wobei sich Liebesgeschichten als Brücke zwischen den Lagern anboten. Die Geschichten bewegten sich im Bereich der Pole Gewalt, Verlust und der Suche nach Identität, in ihrer Gestaltung zwischen ambiguer oder tragischer Couleur, waren selten jedoch explizit politisch. Eine Ausnahme stellte Andrzej Wajdas Danton von 1983 dar, der, basierend auf dem Theaterstück von Stanisława Przybyszewska, hochpolitisiert daherkam und Wajdas Erfahrungen mit der Solidarność-Bewegung und der Ausrufung des Kriegsrechts 1981 in Polen widerspiegelte.
Die 1980er-Jahre bedeuteten für Frankreich eine Zeit des Umbruchs: François Mitterrand wurde 1981 der erste sozialistische Präsident seit Jahrzehnten, während kulturell eine Neuentdeckung der „großen französischen Geschichte“ einsetzte. Damit ist keine ideologisch geprägte Ausrichtung gemäß der 1950er-Jahre gemeint, sondern so etwas wie ein postmoderner Bilderkosmos, der sich oftmals als ambivalent oder nostalgisch aufgeladen erwies. In diesem Kontext erfuhr die Revolution eine Umdeutung weg vom Bild des progressiven, heroischen Ideals, hin zu einem emotional und psychologisch aufgeladenen Trauma – oder alternativ zu einer romantisierten Kulisse. Klassische Monarchisten und Royalisten war selten die Heldenrolle vergönnt. Dafür häuften sich diejenigen Figuren, die für eine verlorene Ordnung, eine persönliche Bindung zur Welt kämpften. Es wurden Kostümfilme mit Blockbuster-Anspruch herausgebracht. Dennoch war Ambivalenz statt Parteinahme vorherrschend und der französische Filmemacher darum bedacht, beide Seiten zu zeigen, wobei sich Liebesgeschichten als Brücke zwischen den Lagern anboten. Die Geschichten bewegten sich im Bereich der Pole Gewalt, Verlust und der Suche nach Identität, in ihrer Gestaltung zwischen ambiguer oder tragischer Couleur, waren selten jedoch explizit politisch. Eine Ausnahme stellte Andrzej Wajdas Danton von 1983 dar, der, basierend auf dem Theaterstück von Stanisława Przybyszewska, hochpolitisiert daherkam und Wajdas Erfahrungen mit der Solidarność-Bewegung und der Ausrufung des Kriegsrechts 1981 in Polen widerspiegelte.
Menschlicher Makel: Marie Antoinettes und ein monumentaler Versuch
 Andere Beispiele sind Ettore Scolas Flucht nach Varennes von 1982, wo mehrere historische Persönlichkeit in den misslungenen Fluchtversuch des Königs im Juni 1791 involviert sind; oder Pierre Granier-Deferres Die Letzten drei Tage der Marie Antoinette von 1989, der von den letzten Tagen der Königin in Gefangenschaft erzählt, kurz bevor sie die unweigerliche Hinrichtung erwartet. Ute Gertrud Lemper obliegt es hierin, dem Publikum die menschliche Seite Marie Antoinettes in ihren letzten drei Tagen auf Erden näherzubringen. 1989 war darüber hinaus ein überaus symbolträchtiges Jahr, da nun die Zweihundertjahrfeier der Revolution anstand. Dies veranlasste Frankreich, Italien, Deutschland, Kanada und Großbritannien dazu, sich in einer multinationalen Großunternehmung an eine filmischen Würdigung der Revolution zu wagen. Unter enormen finanziellem und logistischem Aufwand – es war mit 50 Millionen US-Dollar das bis dato teuerste europäische Filmprojekt – entstand Die Französische Revolution. Dieses mehrteilige monumentale Historiendrama mit namhafter internationaler Besetzung bis in die kleinsten Nebenrollen hatte es sich auf die Fahne geschrieben, bei größtmöglicher historischer Präzision und Geschichtstreue die ersten fünf Jahre der Revolution von 1789 bis 1794 dramaturgisch aufzuarbeiten. Über zwei Teile, Jahre der Hoffnung und Jahre des Zorns mit insgesamt sechs Stunden Laufzeit, erstreckt sich diese minutiöse Nachstellung der wichtigsten Ereignisse: Angefangen bei der Einberufung der Generalstände, über den Ballhausschwur, den Sturm auf die Bastille, die Erklärung der Menschenrechte, den Marsch der Pariser Frauen, die Flucht nach Varennes, das Massaker auf dem Marsfeld, den Tuileriensturm, die Ausrufung der Ersten Französischen Republik, das Septembermassaker, die Exekutionen des Königs und seiner Frau, den Aufstand der Vendée, die Terrorherrschaft, endend mit Robespierres Sturz und im Thermidorianer-Putsch. Es ist bis zum heutigen Tage der längste und umfassendste Spielfilm, der sich mit der Revolutionszeit beschäftigt, dabei historisch in der Tat so akkurat bleibt, wie es seinerzeit möglich war.
Andere Beispiele sind Ettore Scolas Flucht nach Varennes von 1982, wo mehrere historische Persönlichkeit in den misslungenen Fluchtversuch des Königs im Juni 1791 involviert sind; oder Pierre Granier-Deferres Die Letzten drei Tage der Marie Antoinette von 1989, der von den letzten Tagen der Königin in Gefangenschaft erzählt, kurz bevor sie die unweigerliche Hinrichtung erwartet. Ute Gertrud Lemper obliegt es hierin, dem Publikum die menschliche Seite Marie Antoinettes in ihren letzten drei Tagen auf Erden näherzubringen. 1989 war darüber hinaus ein überaus symbolträchtiges Jahr, da nun die Zweihundertjahrfeier der Revolution anstand. Dies veranlasste Frankreich, Italien, Deutschland, Kanada und Großbritannien dazu, sich in einer multinationalen Großunternehmung an eine filmischen Würdigung der Revolution zu wagen. Unter enormen finanziellem und logistischem Aufwand – es war mit 50 Millionen US-Dollar das bis dato teuerste europäische Filmprojekt – entstand Die Französische Revolution. Dieses mehrteilige monumentale Historiendrama mit namhafter internationaler Besetzung bis in die kleinsten Nebenrollen hatte es sich auf die Fahne geschrieben, bei größtmöglicher historischer Präzision und Geschichtstreue die ersten fünf Jahre der Revolution von 1789 bis 1794 dramaturgisch aufzuarbeiten. Über zwei Teile, Jahre der Hoffnung und Jahre des Zorns mit insgesamt sechs Stunden Laufzeit, erstreckt sich diese minutiöse Nachstellung der wichtigsten Ereignisse: Angefangen bei der Einberufung der Generalstände, über den Ballhausschwur, den Sturm auf die Bastille, die Erklärung der Menschenrechte, den Marsch der Pariser Frauen, die Flucht nach Varennes, das Massaker auf dem Marsfeld, den Tuileriensturm, die Ausrufung der Ersten Französischen Republik, das Septembermassaker, die Exekutionen des Königs und seiner Frau, den Aufstand der Vendée, die Terrorherrschaft, endend mit Robespierres Sturz und im Thermidorianer-Putsch. Es ist bis zum heutigen Tage der längste und umfassendste Spielfilm, der sich mit der Revolutionszeit beschäftigt, dabei historisch in der Tat so akkurat bleibt, wie es seinerzeit möglich war.
Knappheit und Liebe
 In den 1990er-Jahren nahm selbst in Frankreich die Zahl der Produktionen drastisch ab, die sich mit der Revolution beschäftigten. 2000 inszenierte Benoît Jacquot Sade – Folge deiner Lust! über den berüchtigten Marquis, hier gespielt von Daniel Auteuil, der 1794 eine Haftstrafe absitzt. 2001 ließ sich Éric Rohmer dazu hinreißen mit Die Lady und der Herzog einen Film über die Revolution zu Wege zu bringen, der seinem konservativem, deutlich revolutionskritischem Gestus entsprach. Knapp zehn Jahre später war es erneut Jacquot, der mit Leb wohl, meine Königin! 2012 ein Drama präsentierte, das, basierend auf dem Buch von Chantal Thomas, über die fiktive Dienstmagd Sidonie Laborde und deren amourösen Gefühle für Marie Antoinette sinniert. In den beengten Räumlichkeiten Versailles angesiedelt, spielt sich das Geschehen überwiegend weit entfernt von revolutionären Brennpunkten ab, vermittelt Angst und Sorge der Oberschicht vor einer beinahe abstrakt gehaltenen Bedrohung. Die angenehm zurückgenommene wie intime Erzählperspektive lebt vor allem durch das Schauspiel Lea Seydouxs als Sidonie und ist eins der Brückenbeispiele, wo in der Liebe nach einer Möglichkeit der Überwindung von Kluften gesucht wird. Demgegenüber stellt sich Pierre Schoellers Ein Volk und sein König von 2018 breiter auf in dem Bemühen, einerseits die Perspektive des Volkes – repräsentiert durch die Familie Françoise Candoles – gegenüber der des Königs, andererseits die politischen Entwicklungen um Robespierre, Marat, Danton unter einen Hut zu bekommen. Mit 121 Minuten Laufzeit gelingt es ihm bestenfalls bedingt, alles zusammen mit den wichtigsten Stationen bis zur Enthauptung des Königs unter einen Hut zu bekommen. Vieles bleibt auf der Strecke, anderes kann bestenfalls angeschnitten werden, zumal die Charaktere gleichsam unter der schwachen wie zu knapp gefassten Darstellung blass bleiben müssen.
In den 1990er-Jahren nahm selbst in Frankreich die Zahl der Produktionen drastisch ab, die sich mit der Revolution beschäftigten. 2000 inszenierte Benoît Jacquot Sade – Folge deiner Lust! über den berüchtigten Marquis, hier gespielt von Daniel Auteuil, der 1794 eine Haftstrafe absitzt. 2001 ließ sich Éric Rohmer dazu hinreißen mit Die Lady und der Herzog einen Film über die Revolution zu Wege zu bringen, der seinem konservativem, deutlich revolutionskritischem Gestus entsprach. Knapp zehn Jahre später war es erneut Jacquot, der mit Leb wohl, meine Königin! 2012 ein Drama präsentierte, das, basierend auf dem Buch von Chantal Thomas, über die fiktive Dienstmagd Sidonie Laborde und deren amourösen Gefühle für Marie Antoinette sinniert. In den beengten Räumlichkeiten Versailles angesiedelt, spielt sich das Geschehen überwiegend weit entfernt von revolutionären Brennpunkten ab, vermittelt Angst und Sorge der Oberschicht vor einer beinahe abstrakt gehaltenen Bedrohung. Die angenehm zurückgenommene wie intime Erzählperspektive lebt vor allem durch das Schauspiel Lea Seydouxs als Sidonie und ist eins der Brückenbeispiele, wo in der Liebe nach einer Möglichkeit der Überwindung von Kluften gesucht wird. Demgegenüber stellt sich Pierre Schoellers Ein Volk und sein König von 2018 breiter auf in dem Bemühen, einerseits die Perspektive des Volkes – repräsentiert durch die Familie Françoise Candoles – gegenüber der des Königs, andererseits die politischen Entwicklungen um Robespierre, Marat, Danton unter einen Hut zu bekommen. Mit 121 Minuten Laufzeit gelingt es ihm bestenfalls bedingt, alles zusammen mit den wichtigsten Stationen bis zur Enthauptung des Königs unter einen Hut zu bekommen. Vieles bleibt auf der Strecke, anderes kann bestenfalls angeschnitten werden, zumal die Charaktere gleichsam unter der schwachen wie zu knapp gefassten Darstellung blass bleiben müssen.
Rechter Geschichtsrevisionismus überschattet die Revolution
 2023 erregte Freiheit oder Tod der Regisseure Paul Mignot und Vincent Mottez über François-Athanase de Charette de la Contrie, einen adligen Anführer des Aufstands in der Vendée, ein weitreichendes mediales Echo und rief Empörung in Frankreich hervor. Bereits die Finanzierung durch die Stiftung Puy du Fou, einem historischen Freizeitpark mit royalistisch-katholischer Grundausrichtung, zog negative Aufmerksamkeit auf sich. Nach seiner Veröffentlichung fühlten sich die Kritiker in ihren Befürchtungen bestätigt: Der Film wurde als bedenklich geschichtsrevisionistisches Werk wahrgenommen, das gezielt die Revolution dämonisiert und die royalistischen Rebellen glorifiziert. In einseitiger und ideologisch geprägter Schwarz-Weiß-Malerei wird die jakobinische Republik als blutrünstiger, repressiver und atheistischer Terrorapparat, die Vendéer hingegen als edle und christliche Freiheitskämpfer dargestellt. Während das rechte Spektrum ihn als notwendige Gegenerzählung zur „linken Revolutionsverklärung“ lobte, kritisierten Linke und Historiker scharf die ideologisch gefährliche Legendenbildung, die der Film betreibt und warnten vor einer Mythisierung der Vendée, die den historischen Kontext verzerrt. Für weniger Aufregung sorgte immerhin Gianluca Jodices Le Déluge von 2024, der, vergleichbar zu Die Letzten drei Tage der Marie Antoinette, ein intimes Portrait von Ludwig XVI. und Marie Antoinette in Gefangenschaft Monate vor ihrer Hinrichtung zeichnet. Der Film konzentriert sich auf die psychologische und emotionale Entwicklung der Hauptfiguren und endet mit einem symbolischen Bild von Marie Antoinette auf dem Weg zur Guillotine.
2023 erregte Freiheit oder Tod der Regisseure Paul Mignot und Vincent Mottez über François-Athanase de Charette de la Contrie, einen adligen Anführer des Aufstands in der Vendée, ein weitreichendes mediales Echo und rief Empörung in Frankreich hervor. Bereits die Finanzierung durch die Stiftung Puy du Fou, einem historischen Freizeitpark mit royalistisch-katholischer Grundausrichtung, zog negative Aufmerksamkeit auf sich. Nach seiner Veröffentlichung fühlten sich die Kritiker in ihren Befürchtungen bestätigt: Der Film wurde als bedenklich geschichtsrevisionistisches Werk wahrgenommen, das gezielt die Revolution dämonisiert und die royalistischen Rebellen glorifiziert. In einseitiger und ideologisch geprägter Schwarz-Weiß-Malerei wird die jakobinische Republik als blutrünstiger, repressiver und atheistischer Terrorapparat, die Vendéer hingegen als edle und christliche Freiheitskämpfer dargestellt. Während das rechte Spektrum ihn als notwendige Gegenerzählung zur „linken Revolutionsverklärung“ lobte, kritisierten Linke und Historiker scharf die ideologisch gefährliche Legendenbildung, die der Film betreibt und warnten vor einer Mythisierung der Vendée, die den historischen Kontext verzerrt. Für weniger Aufregung sorgte immerhin Gianluca Jodices Le Déluge von 2024, der, vergleichbar zu Die Letzten drei Tage der Marie Antoinette, ein intimes Portrait von Ludwig XVI. und Marie Antoinette in Gefangenschaft Monate vor ihrer Hinrichtung zeichnet. Der Film konzentriert sich auf die psychologische und emotionale Entwicklung der Hauptfiguren und endet mit einem symbolischen Bild von Marie Antoinette auf dem Weg zur Guillotine.
Blick über den Tellerrand: Andere Länder, andere Sitten Natürlich kann diese Übersicht nur einen Bruchteil der Filme vorführen, die sich des Themas der Französischen Revolution angenommen haben. Kurzfilme, Dokumentationen und Fernsehserien, sowie solcherlei Geschichten, welche die Revolution womöglich nur am Rande streifen, mussten hierbei ebenso außen vorgelassen werden, wie die Vielzahl der Produktionen aus weiteren Ländern neben Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland hat sich beispielsweise hin und wieder an Filmen über Danton versucht; in Großbritannien waren zeitweise Mantel-und-Degen-Abenteuer über den „roten Pimpernel“ und Scaramouche beliebt. Auch die eine oder andere Marquis-de-Sade-Verfilmung musste unerwähnt bleiben und vieles weiteres unter den Tisch fallen. Ebenso sind Fantasy-Filme wie Highlander III – Die Legende, Pakt der Wölfe oder Die Besucher – Sturm auf die Bastille mit der Revolution verknüpft. Selbst Japan hat mit Lady Oscar: Die Rose von Versailles einen in späteren Bänden inhaltlich auf die Revolutionszeit zusteuernden Manga und darauf basierenden Anime hervorgebracht. Dieser wurde wiederum 1978 mit Lady Oscar in Koproduktion mit Frankreich als Live-Action-Adaption umgesetzt. Auch die Netflix-Animationsserie Castlevania: Nocturne, der Nachfolger zur Erfolgreichen Mutterserie Castlevania, ist 1792 während der Revolution angesiedelt.
Natürlich kann diese Übersicht nur einen Bruchteil der Filme vorführen, die sich des Themas der Französischen Revolution angenommen haben. Kurzfilme, Dokumentationen und Fernsehserien, sowie solcherlei Geschichten, welche die Revolution womöglich nur am Rande streifen, mussten hierbei ebenso außen vorgelassen werden, wie die Vielzahl der Produktionen aus weiteren Ländern neben Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland hat sich beispielsweise hin und wieder an Filmen über Danton versucht; in Großbritannien waren zeitweise Mantel-und-Degen-Abenteuer über den „roten Pimpernel“ und Scaramouche beliebt. Auch die eine oder andere Marquis-de-Sade-Verfilmung musste unerwähnt bleiben und vieles weiteres unter den Tisch fallen. Ebenso sind Fantasy-Filme wie Highlander III – Die Legende, Pakt der Wölfe oder Die Besucher – Sturm auf die Bastille mit der Revolution verknüpft. Selbst Japan hat mit Lady Oscar: Die Rose von Versailles einen in späteren Bänden inhaltlich auf die Revolutionszeit zusteuernden Manga und darauf basierenden Anime hervorgebracht. Dieser wurde wiederum 1978 mit Lady Oscar in Koproduktion mit Frankreich als Live-Action-Adaption umgesetzt. Auch die Netflix-Animationsserie Castlevania: Nocturne, der Nachfolger zur Erfolgreichen Mutterserie Castlevania, ist 1792 während der Revolution angesiedelt.
Ein Plädoyer wider Geschichtsvergessenheit
 Vielleicht erscheint es so, als habe ich sodann meine These von der mangelhaften medialen Repräsentation selbst widerlegt. Die Französische Revolution ist in vielerlei Gestalt und Form adaptiert, verarbeitet und thematisiert worden. Mal mit mehr und mal mit weniger durchgreifendem Erfolg. Sogar in der Welt der Videospiele ist die Revolution angelangt, etwa 2014 in Assassin’s Creed: Unity. Eine Erkenntnis, die sich zumindest für mich ergeben hat, ist, dass es über alle Maße schwierig ist, die Revolution als Phänomen in seiner Gesamtheit mit all seinen politischen, gesellschaftlichen, religiösen, biografischen Aspekten, all den lang-, mittel- und kurzfristigen Folgen, Auswirkungen und Konsequenzen für Frankreich, Europa und die Welt in ein prägnantes filmisches Korsett zu zwängen. Das muss zwangsläufig aus allen Nähten platzen. Selbst der nach wie vor umfangreichste, ambitionierte Versuch die Französische Revolution von 1989 ist dermaßen dicht und kompakt überfüllt mit Informationen, Ereignissen, Personen und Schauplätzen, dass jemand leicht damit überfordert sein kann – und das bei sechs Stunden Laufzeit. Trotz alledem bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wieder mehr Beschäftigung mit den Umständen und Entwicklungen, nicht zuletzt den Folgen der Revolutionen uns allen gut täte – medial und andernorts. Zumal rechte Kreise bereits begonnen haben, selbst dieses Thema für sich zu vereinnahmen und dessen Errungenschaft zu attackieren. Darum mein Plädoyer: Es ist wichtig, sich mit der Revolution und anderen Kämpfen um Demokratie und Freiheit zu beschäftigen. Heute mehr denn je.
Vielleicht erscheint es so, als habe ich sodann meine These von der mangelhaften medialen Repräsentation selbst widerlegt. Die Französische Revolution ist in vielerlei Gestalt und Form adaptiert, verarbeitet und thematisiert worden. Mal mit mehr und mal mit weniger durchgreifendem Erfolg. Sogar in der Welt der Videospiele ist die Revolution angelangt, etwa 2014 in Assassin’s Creed: Unity. Eine Erkenntnis, die sich zumindest für mich ergeben hat, ist, dass es über alle Maße schwierig ist, die Revolution als Phänomen in seiner Gesamtheit mit all seinen politischen, gesellschaftlichen, religiösen, biografischen Aspekten, all den lang-, mittel- und kurzfristigen Folgen, Auswirkungen und Konsequenzen für Frankreich, Europa und die Welt in ein prägnantes filmisches Korsett zu zwängen. Das muss zwangsläufig aus allen Nähten platzen. Selbst der nach wie vor umfangreichste, ambitionierte Versuch die Französische Revolution von 1989 ist dermaßen dicht und kompakt überfüllt mit Informationen, Ereignissen, Personen und Schauplätzen, dass jemand leicht damit überfordert sein kann – und das bei sechs Stunden Laufzeit. Trotz alledem bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass wieder mehr Beschäftigung mit den Umständen und Entwicklungen, nicht zuletzt den Folgen der Revolutionen uns allen gut täte – medial und andernorts. Zumal rechte Kreise bereits begonnen haben, selbst dieses Thema für sich zu vereinnahmen und dessen Errungenschaft zu attackieren. Darum mein Plädoyer: Es ist wichtig, sich mit der Revolution und anderen Kämpfen um Demokratie und Freiheit zu beschäftigen. Heute mehr denn je.
Geschrieben von Jan Bantel
Gefällt mir Wird geladen …
![]() In Gaming – Eine Pixel-Zeitreise nehmen uns Zeichnerin Émile Rouge und Texter Jean Zeid mit auf eine Comicreise durch die Videospielgeschichte. Eingebettet ist ihre Erkundungstour durch fast achtzig Jahre Videospielhistorie in einen unterhaltsamen Reisebericht. In diesem Rahmen unternehmen die Comic-Alter-Egos der Autoren in Begleitung der künstlichen Intelligenz Roby, und bewaffnet mit einem exotischen Impulsgewehr, eine Zeitreise, um den Ursprüngen und vielfältigen wie verflochtenen Entwicklungen ihres liebsten Hobbys nachzuspüren. An gegebener Stelle müssen sie leibhaftig einige thematisch passende Gaming-Abenteuer überstehen. In zwölf Kapiteln plus Prolog und Epilog zeichnen sie diverse Stationen nach, die die Genese des Videospiels über die Jahrzehnte durchlaufen hat. Sie gehen auf technische Ursprünge, die Keime der ersten Computer- und Konsolensysteme ein, benennen Pioniere und Pionierinnen und zeigen auf, wie eng bereits diese ersten Schritte mit dem Phänomen Videospiel verknüpft waren. Sie berichten vom Zauber der Arcade-Spielautomaten, dem aufkommenden Konsolenmarkt und dem ersten Crash in den 1980er-Jahren. Sie erzählen von der Renaissance der Videospiele befeuert durch Nintendo und den Gaming-Galionsfiguren wie Super Mario oder Sonic the Hedgehog. Sie zeigen Trends auf, die sich durch technische Innovationen wie dem Aufkommen der Compact Disc oder dem Smartphone herausgebildet haben und erklären neue Genres, die der Fortschritt von Technik und Markt hervorgebracht haben.
In Gaming – Eine Pixel-Zeitreise nehmen uns Zeichnerin Émile Rouge und Texter Jean Zeid mit auf eine Comicreise durch die Videospielgeschichte. Eingebettet ist ihre Erkundungstour durch fast achtzig Jahre Videospielhistorie in einen unterhaltsamen Reisebericht. In diesem Rahmen unternehmen die Comic-Alter-Egos der Autoren in Begleitung der künstlichen Intelligenz Roby, und bewaffnet mit einem exotischen Impulsgewehr, eine Zeitreise, um den Ursprüngen und vielfältigen wie verflochtenen Entwicklungen ihres liebsten Hobbys nachzuspüren. An gegebener Stelle müssen sie leibhaftig einige thematisch passende Gaming-Abenteuer überstehen. In zwölf Kapiteln plus Prolog und Epilog zeichnen sie diverse Stationen nach, die die Genese des Videospiels über die Jahrzehnte durchlaufen hat. Sie gehen auf technische Ursprünge, die Keime der ersten Computer- und Konsolensysteme ein, benennen Pioniere und Pionierinnen und zeigen auf, wie eng bereits diese ersten Schritte mit dem Phänomen Videospiel verknüpft waren. Sie berichten vom Zauber der Arcade-Spielautomaten, dem aufkommenden Konsolenmarkt und dem ersten Crash in den 1980er-Jahren. Sie erzählen von der Renaissance der Videospiele befeuert durch Nintendo und den Gaming-Galionsfiguren wie Super Mario oder Sonic the Hedgehog. Sie zeigen Trends auf, die sich durch technische Innovationen wie dem Aufkommen der Compact Disc oder dem Smartphone herausgebildet haben und erklären neue Genres, die der Fortschritt von Technik und Markt hervorgebracht haben.![]() Über die Expansion der Triple-A-Titel, Online-Rollenspiele wie World of Warcraft, die E-Sports-Szene bis hin zu unabhängigen Entwicklerstudios gelangen sie in die Gegenwart. Gemessen am Umfang und der schier unmöglich zu erfassenden Bandbreite von Arcade-, Konsolen-, PC-, Handheld- und Mobile-Games wundert es nicht, dass die meisten Bereiche bloß angeschnitten werden. Die Namen von kreativen Köpfen, Genies und Entwicklern und Entwicklerinnen der Videospielgeschichte sind stellenweise kaum mehr als Namedroppings mit einem Minimum an Informationen über ihre mal mehr und mal weniger ausschlaggebenden Beiträge zum Reifeprozess. Dafür punktet der Comic mit Vielfalt: Neben den Shootingstars der Szene wie Doom- und Wolfenstein-Co-Entwickler Alfonso John Romero, Super-Mario-Bros.- und The-Legend-of-Zelda-Erfinder Miyamoto Shigeru und Kojima Hideo, dem kreativen Geist hinter Metal Gear Solid und Death Stranding, finden auch weniger renommierte oder gar in Vergessenheit geratene Personen Platz, wie etwa Gerald Anderson „Jerry“ Lawson, einer der wenigen herausragenden People of Color der Videospielwelt. Positiv ist zu vermerken, dass die Rolle der weiblichen Entwickler und sogar von den wenigen LGBTQ-Personen hervorgehoben wird, sodass der Leser mit Vorreiterinnen wie Roberta Williams oder Rebecca Ann Heineman Bekanntschaft macht. Auch weibliche Gaming-Ikonen wie Tomb Raider erfahren eine angemessene Würdigung.
Über die Expansion der Triple-A-Titel, Online-Rollenspiele wie World of Warcraft, die E-Sports-Szene bis hin zu unabhängigen Entwicklerstudios gelangen sie in die Gegenwart. Gemessen am Umfang und der schier unmöglich zu erfassenden Bandbreite von Arcade-, Konsolen-, PC-, Handheld- und Mobile-Games wundert es nicht, dass die meisten Bereiche bloß angeschnitten werden. Die Namen von kreativen Köpfen, Genies und Entwicklern und Entwicklerinnen der Videospielgeschichte sind stellenweise kaum mehr als Namedroppings mit einem Minimum an Informationen über ihre mal mehr und mal weniger ausschlaggebenden Beiträge zum Reifeprozess. Dafür punktet der Comic mit Vielfalt: Neben den Shootingstars der Szene wie Doom- und Wolfenstein-Co-Entwickler Alfonso John Romero, Super-Mario-Bros.- und The-Legend-of-Zelda-Erfinder Miyamoto Shigeru und Kojima Hideo, dem kreativen Geist hinter Metal Gear Solid und Death Stranding, finden auch weniger renommierte oder gar in Vergessenheit geratene Personen Platz, wie etwa Gerald Anderson „Jerry“ Lawson, einer der wenigen herausragenden People of Color der Videospielwelt. Positiv ist zu vermerken, dass die Rolle der weiblichen Entwickler und sogar von den wenigen LGBTQ-Personen hervorgehoben wird, sodass der Leser mit Vorreiterinnen wie Roberta Williams oder Rebecca Ann Heineman Bekanntschaft macht. Auch weibliche Gaming-Ikonen wie Tomb Raider erfahren eine angemessene Würdigung.![]() Das Motto „Überfülle“ gilt genauso für die vorgestellten Spiele. Ob Half-Life, Assassin’s Creed, Die Sims oder etwaige Beat ’em ups und Platformer – im Comic wird eine immense Zahl genannt, was zeigt, dass viele Details und Eigenheiten unerwähnt bleiben. Nicht jeder wird damit zufrieden sein, wie kurz sein Lieblingsspiel behandelt wird. Manchmal verpasst es der Comic, das Alleinstellungsmerkmal eines Titels deutlich zu machen und andere Games fehlen womöglich ganz. Dafür verweisen Zeid und Rouge auf die weniger bequemen Themen, die Schattenseiten und Skandale der Videospielwelt, etwa Vorwürfe wegen Gewaltdarstellung oder Suchtgefahr von Spielen, aber auch auf schwerwiegende brancheninterne Probleme wie Cybermobbing, Sexismus und Crunch, die Mehrarbeit und unbezahlten Überstunden, zu denen Mitarbeiter in diversen Studios genötigt sind. Bei allem dichten Informationsgehalt ist Rouge und Zeid ihre Leidenschaft für die Materie anzumerken. Sie sind unverkennbar enthusiastische Gamer. Zu Zeids „Lieblingsmenschen“ zählen Dr. Gordon Freeman und Ezio Auditore da Firenze. Rouge ist neben World of Warcraft großer Fan der Fallout-Spiele. Nicht zuletzt deswegen haben sie sichtlich Spaß daran, sich in Comicgestalt in die Historie ihres Hobbys zu stürzen. Durch ihren in der Tat spielerischen Umgang mit der Materie entsteht nie der Eindruck, die Rahmenhandlung sei bloß ein auflockerndes Gimmick. Im Gegenteil geben sie der Geschichte so viel von sich und ihrer Begeisterung bei, dass der Leser meinen könnte, tatsächlich der Reise von zwei Enthusiasten als lesender Passagier beizuwohnen.
Das Motto „Überfülle“ gilt genauso für die vorgestellten Spiele. Ob Half-Life, Assassin’s Creed, Die Sims oder etwaige Beat ’em ups und Platformer – im Comic wird eine immense Zahl genannt, was zeigt, dass viele Details und Eigenheiten unerwähnt bleiben. Nicht jeder wird damit zufrieden sein, wie kurz sein Lieblingsspiel behandelt wird. Manchmal verpasst es der Comic, das Alleinstellungsmerkmal eines Titels deutlich zu machen und andere Games fehlen womöglich ganz. Dafür verweisen Zeid und Rouge auf die weniger bequemen Themen, die Schattenseiten und Skandale der Videospielwelt, etwa Vorwürfe wegen Gewaltdarstellung oder Suchtgefahr von Spielen, aber auch auf schwerwiegende brancheninterne Probleme wie Cybermobbing, Sexismus und Crunch, die Mehrarbeit und unbezahlten Überstunden, zu denen Mitarbeiter in diversen Studios genötigt sind. Bei allem dichten Informationsgehalt ist Rouge und Zeid ihre Leidenschaft für die Materie anzumerken. Sie sind unverkennbar enthusiastische Gamer. Zu Zeids „Lieblingsmenschen“ zählen Dr. Gordon Freeman und Ezio Auditore da Firenze. Rouge ist neben World of Warcraft großer Fan der Fallout-Spiele. Nicht zuletzt deswegen haben sie sichtlich Spaß daran, sich in Comicgestalt in die Historie ihres Hobbys zu stürzen. Durch ihren in der Tat spielerischen Umgang mit der Materie entsteht nie der Eindruck, die Rahmenhandlung sei bloß ein auflockerndes Gimmick. Im Gegenteil geben sie der Geschichte so viel von sich und ihrer Begeisterung bei, dass der Leser meinen könnte, tatsächlich der Reise von zwei Enthusiasten als lesender Passagier beizuwohnen.![]() Zeid gibt überwiegend den Part des akademisch angehauchten Erzählers, in dessen Worten nichtsdestoweniger immerzu die mühsam im Zaum gehaltene Erregung des Nerds selbst für die drögeren technischen Aspekte mitschwingt. Rouge repräsentiert demgegenüber die jüngere Generation, die bereits mit den moderneren Auswüchsen der Szene groß geworden ist und stärker an den Spielen als an den technischen Hintergründen interessiert zu sein scheint respektive mehr auf Action als auf Erzählen aus ist. Das korrespondiert letztlich mit ihren Rollen bei der Entstehung des Comics, wo Zeid den Text und die Informationen liefert, die durch Rouges detailverliebten und anspielungsreichen Zeichnungen, die erwähnten Personen, Spielszenen oder Cover-Artworks illustrieren, zum Leben erweckt werden. Die generationsbedingten Unterschiede ergeben darüber hinaus eine spaßige Screwball-Dynamik, die teils aus kleineren Sticheleien zwischen den beiden, teils aus der gemeinsamen Gaming-Leidenschaft besteht, die letztlich alle Klüfte zwischen den Altersklassen überbrückt. Roby ergänzt Zeids Erzählung immer wieder mit enzyklopädischen Einwürfen zu diesem oder jenem Schlagwort und wird deswegen nicht selten gleichfalls Ziel des Spotts durch den Autor, der ihm die maschinelle Aufsagung von Definitionen oder Fakten gerne neckisch vorwirft. Dafür ist Roby am Ende immerhin ein kleiner Twist vergönnt.
Zeid gibt überwiegend den Part des akademisch angehauchten Erzählers, in dessen Worten nichtsdestoweniger immerzu die mühsam im Zaum gehaltene Erregung des Nerds selbst für die drögeren technischen Aspekte mitschwingt. Rouge repräsentiert demgegenüber die jüngere Generation, die bereits mit den moderneren Auswüchsen der Szene groß geworden ist und stärker an den Spielen als an den technischen Hintergründen interessiert zu sein scheint respektive mehr auf Action als auf Erzählen aus ist. Das korrespondiert letztlich mit ihren Rollen bei der Entstehung des Comics, wo Zeid den Text und die Informationen liefert, die durch Rouges detailverliebten und anspielungsreichen Zeichnungen, die erwähnten Personen, Spielszenen oder Cover-Artworks illustrieren, zum Leben erweckt werden. Die generationsbedingten Unterschiede ergeben darüber hinaus eine spaßige Screwball-Dynamik, die teils aus kleineren Sticheleien zwischen den beiden, teils aus der gemeinsamen Gaming-Leidenschaft besteht, die letztlich alle Klüfte zwischen den Altersklassen überbrückt. Roby ergänzt Zeids Erzählung immer wieder mit enzyklopädischen Einwürfen zu diesem oder jenem Schlagwort und wird deswegen nicht selten gleichfalls Ziel des Spotts durch den Autor, der ihm die maschinelle Aufsagung von Definitionen oder Fakten gerne neckisch vorwirft. Dafür ist Roby am Ende immerhin ein kleiner Twist vergönnt.